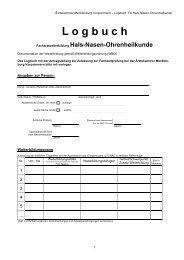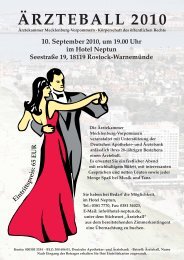Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auch Patienten selbst stellen müssen. Blech meint es ginge<br />
auch mit weniger. Doch zweifellos: „Medizin schafft Nachfrage<br />
nach noch mehr Medizin.“<br />
Am Ende seines Buches macht der Autor Vorschläge für ein<br />
gesundes Leben und nennt sieben Rezepte gegen eine Übertherapie.<br />
Auf 14 Seiten hat er seine Quellen aufgelistet.<br />
Der Glaube der Patienten an die Medizin ist groß und verständlich.<br />
Lesen sie aber dieses Buch, so wird dieser Glaube erschüttert.<br />
Also empfiehlt sich für alle Ärzte, es zu lesen, nachzudenken,<br />
sich zu besinnen und schließlich vor allem zu handeln!<br />
Literatur und Medizin<br />
Ein Lexikon<br />
Hrsg.: Bettina von Jagow und Florian Steger<br />
Vandenhoeck & Ruprecht 2005<br />
983 Seiten, € 59,00<br />
ISBN 3-525-21018-3<br />
AUSGABE 5 / <strong>2006</strong> 16. JAHRGANG<br />
Dr. C. Brock, Neubrandenburg<br />
Bildeten die Kreuzungspunkte<br />
von Heilkunde<br />
und Dichtkunst seit jeher<br />
ein attraktives und<br />
ergiebiges medizin- wie<br />
literarhistorisches Studienfeld,<br />
das bis in die<br />
europäische Frühzeit zurückreicht,<br />
so repräsentieren<br />
dessen in Einzeluntersuchungendargelegten<br />
Erträge gleichwohl<br />
nur mehr oder<br />
weniger begrenzte Ausschnitte<br />
aus dem entwicklungsgeschichtlichen<br />
Kontinuum beider<br />
Kulturbereiche. Es blieb gewissermaßen bei geistesgeschichtlichen<br />
Momentaufnahmen der jeweils anvisierten<br />
Zeiträume, deren ausgewählten Vertretern sich das wissenschaftliche<br />
Interesse mit seinen unterschiedlichen Fragestellungen<br />
zugewandt hatte.<br />
Wenn Dietrich von Engelhardt vor wenigen Jahrzehnten<br />
noch feststellen mußte, „daß eine umfassende Darstellung<br />
des Verhältnisses von Medizin und Literatur noch nicht veröffentlicht<br />
wurde“ (Dt. Vierteljahrsschr. f. Literaturwiss. u.<br />
Geistesgesch. 52, 3, S. 380), so konnte er nunmehr einem<br />
Opus von inhaltlich wie methodisch herausragender Qualität<br />
ein Geleitwort (Spalten 1-6) mitgeben, das sein 1978 formu-<br />
BUCHVORSTELLUNGEN<br />
liertes Desiderat im Gewande eines sachlich-systematisch angelegten<br />
Wissensspeichers mit über 250 Stichwörtern als lexikalisch<br />
verwirklicht erscheinen lassen kann. Dessen verdienstvolle<br />
Herausgeber Bettina v. Jagow und Florian Steger unterzogen<br />
sich zusammen mit 80 Fachvertretern der Literaturwissenschaft<br />
und der Medizingeschichte (Verzeichnis Sp. 981-<br />
984) in interdisziplinärer und internationaler Kooperation<br />
einer humanwissenschaftlichen Forschungsaufgabe von nicht<br />
zu überschätzendem Gewicht, deren Realisierung die vielschichtige<br />
und folgenreiche Wechselwirkung zweier großer<br />
Denksysteme ins Bewußtsein ruft und zur Transparenz verhilft.<br />
Das anspruchsvolle Unternehmen bewegt sich in einer zeitlichen<br />
Dimension, die mit der Antike beginnt und in der Gegenwart<br />
endet, wobei daran zu erinnern bleibt, daß die Entwicklungsphasen<br />
der Medizingeschichte und die der Literatur<br />
keineswegs identisch sind, worauf Dietrich v. Engelhardt in<br />
seinem Geleitwort (Sp. 3) noch einmal ausdrücklich hinweist.<br />
Wenn für die Aufnahme der Stichwörter der Grad ihrer wechselseitigen<br />
Gewichtigkeit für Literatur und Medizin zugrunde<br />
gelegt werden konnte, so dürfte die Selektion der die abgehandelten<br />
Begriffe literarisch repräsentierenden „Schnittstellen“<br />
angesichts ihrer kaum überschaubaren Fülle den Verfassern<br />
materialbegrenzende Entscheidungen und Verzichte<br />
nicht leicht gemacht haben. Neben der dank gründlicher Belesenheit<br />
allen denkbaren Gattungen schriftstellerischer Produktion<br />
entnommenen Zeugnisse „literarisierter Medizin“<br />
deutscher Sprache werden auch die in überraschender Reichhaltigkeit<br />
zitierten Textbelege englischer, französischer, italienischer,<br />
spanischer und russischer Autoren in die subtilen<br />
Analysen und zeitnah problemorientierten Interpretationen<br />
einbezogen. Ein Personenregister (Sp. 873-912) und ein ausführliches<br />
Werkregister (Sp. 912-980) schließen das Lexikon<br />
ab.<br />
Es wäre ungewöhnlich, wenn auch ein großer Wurf – wie der<br />
hier zu bewertende – keine Wünsche offen ließe. So ist die<br />
im Vorwort (Sp.11) jeweils für den „ersten Teil eines Lemmas“<br />
verheißene „begriffs-respektive kulturgeschichtliche“ Darstellung<br />
des jeweiligen Stichwortes leider nicht konsequent realisiert<br />
worden. Gerade im Interesse jüngerer, vor allem noch<br />
in der Ausbildung befindlicher Leser gehört aber die Verdeutlichung<br />
wortgeschichtlicher Zusammenhänge angesichts einer<br />
schockierenden Bildungsverflachung zu den philologischen<br />
Hilfestellungen von unbestrittener Dringlichkeit. Neben hinlänglich<br />
erläuterten Begriffen wie „Hypochondrie, Melancholie,<br />
Norm, Plazebo“ und sogar „Eifersucht“ oder „Heimweh“<br />
findet sich ein nicht unbeträchtlicher Anteil etymologisch<br />
unkommentiert belassener Lexik, beispielsweise „Inzest, Epilepsie,<br />
Euthanasie“ oder auch „Symptom“. Diese sprachlichen<br />
SEITE 177