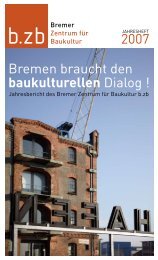Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...
Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...
Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
aulichen und stadträumlichen Qualitäten wichtig. Wilfried Turk schrieb 1980: „Es<br />
geht um die Kontinuität öffentlichen Raumes, die Wiedergewinnung von Straßen<br />
und die Entwicklung neuer sozialer Raumcharaktere, die die Übergangszone von<br />
Öffentlichkeit zu Privatheit neu definiert und entsprechend gestaltet.“ 19 Auf die<br />
heutige Zeit übertragen: Das Alt-Bremer Haus erlaubt eine Dichte und Komplexität,<br />
die die Renaissance einer emotionalen, vitalen Stadt ermöglicht.<br />
Zusammengefasst überzeugt, wie das Bremer Haus Paradigmenwechsel<br />
und Kriege überstanden hat, wie es dann als Leuchtturm städtischer Wohnzufriedenheiten<br />
wiederentdeckt wurde und immer wieder Planer- und <strong>Architekten</strong>köpfe<br />
inspiriert und angespornt hat – wie durchgängig in diesem Buch zu sehen und zu<br />
lesen ist.<br />
zWISCHEn DEn KRIEgEn: hohe zeit für den<br />
Wohnungsbau<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Inflation, mit dem Wiederaufstieg der<br />
Wirtschaft in der Weimarer Republik und so auch in der Hafenstadt <strong>Bremen</strong><br />
gewinnt vor allem der Arbeiter- und, wie es später heißt, Kleinstwohnungsbau<br />
an Bedeutung; zunächst als Grundversorgung in einem schier aussichtslosen<br />
Kampf gegen die Wohnraumnot. Später erfassen der Aufbruchsgeist der Weimarer<br />
Republik und eine „kommende Baukunst“ 20 vor allem die <strong>Architekten</strong> und<br />
Techniker – mit neuen Materialien, revolutionären Fertigungsmethoden und großer<br />
Geschwindigkeit. Nachzuvollziehen an der berühmten Wohnsiedlung Karlsruhe-<br />
Dammerstock: „das endziel der siedlung ist also die schaffung von gesunden<br />
praktischen gebrauchswohnungen, die dem sozialen standard der durchschnittsfamilie<br />
von heute entsprechen und trotz solider technischer durchführung und anmutiger<br />
gestaltung für das durchschnittseinkommen erschwinglich sind“ schrieb<br />
in einer aktuellen Variante von Vitruv 1929 Walter Gropius in den Katalog zur Ausstellung<br />
21 . Und die Grundrisse der großen und kleinen Häuser wirken in ihrer Akkuratesse<br />
und Sinnlichkeit wie die Blaupausen vieler Entwürfe unserer Tage.<br />
Kleinwohnungsbau, Frankfurter Küche und neue<br />
Gemütlichkeit<br />
Berliner Großsiedlungen entstehen als gebautes Dokument eines neuen<br />
Zeitalters, 22 als adäquate heroische Großform wie in Britz (Hufeisensiedlung) oder<br />
Siemensstadt (Ringsiedlung). Heute zählen sie zum Weltkulturerbe. So wie experimentelle<br />
Werkbundsiedlungen in Wien oder Breslau oder die berühmte <strong>Weiße</strong>nhofsiedlung<br />
in Stuttgart Höhepunkte der Baukunst des 20. Jahrhunderts sind. <strong>Die</strong><br />
Einbauküche nach Entwürfen von Margarete Schütte-Lihotzky (Frankfurter Küche,<br />
1926/27) kennzeichnet die Veränderung im Wohnen am besten: Hier wurde<br />
die ideologische Aufwertung der Hausfrauenarbeit zum Beruf durch einen perfekten,<br />
absolut neuen technischen Ausbauzustand gewürdigt. <strong>Die</strong>se Küche ist eine<br />
Lobpreisung der „Befreiung der Frau durch Rationalisierung des Haushalts“ 23 , ein<br />
leistungsorientierter Arbeitsplatz, integriert in die Wohnung.<br />
Jetzt aber regiert ein neuer Küchenkult. Ein Ausriss aus Mein Heim – praktisch,<br />
behaglich, schön von 1932 zeigt es: beispielsweise mit einem „Weekend“-<br />
16 17 ALLES GANZ EiNFACH UND KOMPLiZiERT!<br />
Küchenschrank. Auf 15 von gut 100 Seiten wird über die Küche mit Kochkisten<br />
und Kochautomaten geschrieben. 24 Das Praktische und Ideologische wird<br />
aber auch schön verpackt. Selbst die „Billige Wohnung“ nach A. G. Schneck von<br />
1928 25 knüpft an eine gewisse, wenn auch abgespeckte Gemütlichkeit der guten<br />
alten wilhelminischen Zeit. In den 1930er Jahren wird wieder bescheidener Wohlstand<br />
für fast alle erreicht und gemütliches Wohnen zum Thema.<br />
Ein Wohnungsbauunternehmen mit hanseatisch sozialem<br />
Auftrag: die GEWOBA<br />
Und in <strong>Bremen</strong>? Avantgarde und Innovation beim Wohnungsbau ist nicht<br />
das Leitthema in der Hansestadt gewesen: <strong>Bremen</strong> sei die Stadt des kleinen Ein-<br />
und Zweifamilienhauses, schrieb einer der Gründer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugemeinschaft<br />
der freien Gewerkschaften für <strong>Bremen</strong> und Umgebung,<br />
die später verkürzt GEWOBA genannt wird 26 ; aber er glaubte auch, man könne<br />
entschieden Neues schaffen, mit der Art der neuen Häuser den Arbeiterfamilien<br />
auch ein anderes, besseres, rationelleres Leben ermöglichen. Beispielhaft und<br />
programmatisch sind die ersten beiden Projekte dieser gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft,<br />
die heute im Land <strong>Bremen</strong> über 40.000 Wohnungen besitzt<br />
und weitere Tausende betreut; eine Gesellschaft, ohne die im 20. Jahrhundert<br />
in <strong>Bremen</strong> keine umfassende Wohnungsbaupolitik hätte garantiert werden<br />
können. <strong>Die</strong> ersten Wohnhäuser, die in einigen Bauabschnitten über mehrere<br />
Jahre in der Altenescher Straße und in Nachbarstraßen errichtet wurden (und<br />
heute noch bestehen), heißen programmatisch „Gewerkschaftsblock“, denn<br />
hier durfte zunächst nur jemand wohnen, der Mitglied der beteiligten Gewerkschaften<br />
war – Mieter waren hoch qualifizierte Facharbeiter und Handwerker.<br />
Eine Vierraumwohnung im Bremer Gewerkschaftsblock mit Küche, Keller und<br />
Bodenkammer kostete monatlich 50 Mark – als ein Werftarbeiter 25 Mark die<br />
Woche als Lohn bekam.<br />
<strong>Die</strong> ersten Bauabschnitte konnten in ihrer Kleinteiligkeit, in der Reihe und mit<br />
Satteldach ihre Verwandtschaft mit dem Bremer Haus nicht leugnen. Wollten sie<br />
auch nicht. Aber innen waren sie für damalige Verhältnisse sensationell fortschrittlich<br />
und sozial organisiert, mit Zentralheizung und ständig verfügbarem warmem<br />
Wasser. In der Kulturgeschichte des Wohnens spielt bis zur heutigen Luxuseigentumswohnung<br />
Wasser eine entscheidende Rolle – neben dem Feuer. Wohnen hat<br />
archaische Wurzeln.<br />
Der Erfolg der ersten beiden Projekte hatte Folgen für die Gesamtentwicklung<br />
des Unternehmens: „Man hatte gewagt und gleich auf Anhieb ein äußerst<br />
vorzeigbares Projekt geschaffen und insbesondere die Versuche einer immer stärkeren<br />
Typisierung bei den Plänen zur Grasberger Straße zeigen, dass man hier<br />
gleich mehr im Sinne hatte (…) man wollte hier bauen und ausprobieren, was an<br />
diesem Projekt vielleicht als Exempel für andere gelten könnte.“ 27 Das nächste<br />
Großprojekt an der Rathenaustraße zeigt den Wandel. Schmückende Elemente<br />
über den Eingangstüren verschwinden: Es dominieren Flachdächer, es wird jetzt<br />
durch <strong>Architekten</strong>wettbewerbe entschieden, „um hellluftig die Zukunft zu zeigen<br />
und kompaktmassig die eigene Kraft zu demonstrieren!“ 28<br />
Mit dem Jahr 1933 geht die GEWOBA allerdings in der gleichgeschalteten<br />
Deutschen Arbeitsfront auf, der Dachorganisation der nationalsozialistischen<br />
Gewerkschaften. <strong>Die</strong> Mustersiedlung „Louis Krages“ in <strong>Bremen</strong>-Burgdamm oder