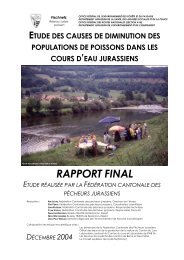DEM FISCHRÜCKGANG AUF DER SPUR - Fischnetz
DEM FISCHRÜCKGANG AUF DER SPUR - Fischnetz
DEM FISCHRÜCKGANG AUF DER SPUR - Fischnetz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Fischnetz</strong>-Schlussbericht Gesundheit<br />
auswirken kann. Der Oberland-/Mittelland-Gradient in der<br />
Fischgesundheit wurde interessanterweise nur im Herbst<br />
beobachtet, nicht jedoch im Frühjahr. Dieser Befund könnte<br />
sich daraus erklären, dass die kranken und damit geschwächten<br />
Tiere im Laufe des Winters sterben, so dass im<br />
Frühjahr nur die gesunden Individuen überlebt haben.<br />
Das Beispiel der Biomonitoring-Studie Bern verdeutlicht<br />
die Probleme bei der Suche nach den Ursachen der Organschädigungen<br />
in Bachforellen. Ein Problem liegt darin, dass<br />
die Fische im Gewässer nicht einzelnen, isoliert wirkenden,<br />
sondern multiplen Faktoren ausgesetzt sind. So verändern<br />
sich mit dem Übergang vom Oberland zum Mittelland nicht<br />
nur die Wasserbelastung mit anthropogenen Stoffen, sondern<br />
auch beispielsweise die Wassertemperatur, die Hydrologie,<br />
die Gewässermorphologie oder die Intensität der klinischen<br />
Manifestation von PKD. Ein weiteres Problem liegt<br />
in der Festlegung von Effekt-Schwellenwerten. So sind beispielsweise<br />
für eine Reihe von toxischen Wasserinhaltsstoffen<br />
Grenzwerte festgelegt, bei deren Einhaltung keine<br />
nachteiligen Folgen für den Fisch auftreten sollen. Es wird<br />
jedoch zunehmend deutlich, dass auch bei Einhaltung solcher<br />
Grenzwerte nachteilige Gesundheitsveränderungen bei<br />
Fischen auftreten können [4, 41]. Das kann daran liegen,<br />
dass bestimmte Stoffgruppen nicht in der Expositionsanalyse<br />
erfasst werden – beispielsweise ist gerade die Exposition<br />
mit episodisch auftretenden, nicht bioakkumulierenden<br />
Pestiziden oft nur schwer abzuschätzen [42]. Andere mögliche<br />
Ursachen sind, dass Kombinationswirkungen nicht<br />
berücksichtigt werden oder dass Grenzwerte, die meist von<br />
letalen Wirkkonzentrationen abgeleitet wurden, nicht ausreichen,<br />
um vor subletalen Effekten zu schützen.<br />
Ein Beispiel für eine Untersuchung, in der versucht wurde,<br />
die Bedeutung eines einzelnen Faktors – ARA-Einleitungen<br />
– auf den Gesundheitszustand der Forellen im Vorfluter zu<br />
erfassen, ist die Studie «Einfluss von Kläranlagen auf den<br />
Gesundheitszustand von Bachforellen» [37]. Dabei wurden<br />
an 31 ARA sowohl oberhalb wie unterhalb der ARA-Einleitungen<br />
Forellen entnommen und auf histologische Veränderungen<br />
von Leber und Gonaden untersucht. Die histologischen<br />
Leberindices der untersuchten Fische (n = 187) streuten zwischen<br />
7 und 52, der Mittelwert lag bei 27± 9,6. Als «hohe»<br />
Leberindices wurden in dieser Studie jene Werte bezeichnet,<br />
welche einen Indexwert aufwiesen, der über dem 75%-<br />
Quantil lag; das 75%-Quantil entsprach 33 Indexpunkten.<br />
Als quantitative Parameter zur Charakterisierung der ARA<br />
wurden die Belastungsstärke (angegeben in Einwohnergleichwerten,<br />
EGW) und die Verdünnung des Abwassers im<br />
Vorfluter genommen. Eine Beziehung zwischen den quantitativen<br />
Charakteristika der ARA und dem Auftreten von<br />
hohen oder niedrigen Leberindices konnte nicht aufgezeigt<br />
werden. So wurden hohe Leberindices unterhalb von Kläranlagenausflüssen<br />
mit guten Verdünnungsverhältnissen<br />
(Abwasseranteil 2–39%) und geringen Belastungsstärken<br />
(2700 –7750 EGW) ebenso gefunden, wie niedrige Leberindices<br />
unterhalb von ARA mit geringem Verdünnungsverhältnis<br />
(Abwasseranteile 45–71%) und hoher Belastungsstärke<br />
(22 500 –186 600 EGW). Offensichtlich lässt sich aus<br />
der Belastungsstärke der ARA und der Abwasserverdünnung<br />
keine Vorhersage zur Auswirkung auf die Fischgesundheit<br />
treffen. Entscheidender als die quantitativen Parameter dürfte<br />
die Qualität – also die chemische Belastung des Abwassers<br />
– sein. Leider liegen jedoch keine Daten zu den Inhaltsstoffen<br />
der ARA-Abwasser vor, so dass diese Hypothese<br />
nicht verifiziert werden kann.<br />
Die Aussage, dass sich keine Korrelation zwischen dem<br />
quantitativen ARA-Eintrag ins Gewässer und der Fischgesundheit<br />
ergibt, wird weiter erhärtet, wenn man die Gesundheitsdaten<br />
von Fischen ober- und unterhalb der ARA-Einleitungen<br />
vergleicht. Wenn man die histologischen Daten von<br />
allen 31 untersuchten ARA zusammennimmt, unterscheidet<br />
sich der Leberindex-Mittelwert der Fische unterhalb der<br />
ARA-Einleitungen nicht signifikant von dem Mittelwert der<br />
Fische oberhalb der Einleitung. Unterschiede zeigen sich<br />
allerdings in einigen Fällen, wenn man die einzelnen Kläranlagen<br />
für sich betrachtet (gepaarter Vergleich). Unterschiede<br />
zwischen ober- und unterhalb der ARA-Einleitung wurden<br />
als «auffallend» beurteilt, wenn sich die Mittelwerte um mindestens<br />
zehn Indexpunkte unterschieden (ein statistischer<br />
Vergleich war auf Grund der geringen Stichprobengrössen<br />
nicht möglich). Dabei zeigte sich, dass bei drei ARA unterhalb<br />
der Einleitung ein auffallend höherer Leberindex vorlag als<br />
oberhalb, während bei sieben ARA die Werte unterhalb der<br />
Einleitung auffallend niedriger waren (hier war also der Gesundheitszustand<br />
der Fische oberhalb der ARA schlechter<br />
als unterhalb). Bei den restlichen ARA traten keine auffallenden<br />
ober-/unterhalb-Unterschiede auf.<br />
Faller et al. [43] untersuchten den Einfluss von ARA-Einleitungen<br />
auf den Gesundheitszustand von Fischen anhand<br />
von Gründlingen. Untersuchungsgewässer waren die Suhre<br />
(LU/AG) und die Ron (LU); beide Flüsse erhalten chemische<br />
Belastungen (unter anderem Pestizide) aus diffusen Quellen,<br />
in die Suhre entwässert ausserdem eine ARA. Der Gesundheitszustand<br />
der Gründlinge wurde mit einer breiten Palette<br />
von Parametern untersucht: Cytochrom P4501A-Protein,<br />
EROD-Aktivität, Konditionsfaktor, Lipidgehalt, Gonado-somatischer<br />
Index, Leber-somatischer Index, Milz-somatischer<br />
Index, Parasitenbefall, Leberhistologie, Plasma-Vitellogenin<br />
und Gonadenhistologie. Zusätzlich wurden die Populationsstruktur<br />
und die Speziesdiversität erfasst. In beiden Gewässern<br />
zeigten die Gründlinge nachteilige Organveränderungen,<br />
wobei sich kein signifikanter Einfluss der ARA-Einleitung<br />
erkennen liess. Unterhalb der ARA war die Populationsstruktur<br />
der Gründlinge nachteilig verändert, dies war jedoch<br />
offensichtlich durch eine frühere akute Nitrit-Intoxikation<br />
bedingt und somit nicht direkt auf die chronischen Gesundheitsbeeinträchtigungen<br />
zurückzuführen.<br />
39