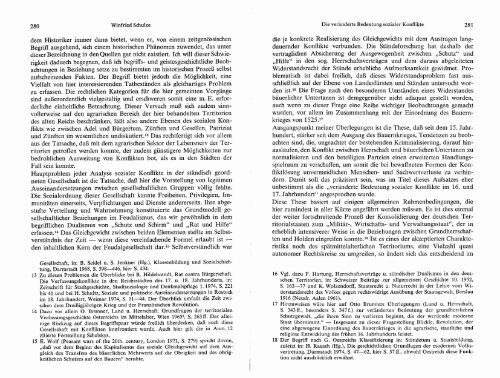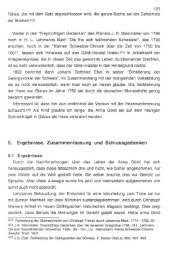1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
280 Winfried Schulze Die veränderte Bedeutung sozialer Konflikte 281<br />
dem Historiker immer dann bietet, wenn er, von einem zeitgenössischen<br />
Begriff ausgehend, sich einem historischen Phänomen zuwendet, <strong>das</strong> unter<br />
<strong>die</strong>ser Bezeichnung in den Quellen gar nicht existiert. Ich will <strong>die</strong>ser Schwierigkeit<br />
dadurch begegnen, daß ich begriffs- und geistesgeschichtliche Beobachtungen<br />
in Beziehung setze zu bestimmten im historischen Prozeß selbst<br />
aufscheinenden Fakten. Der Begriff bietet jedoch <strong>die</strong> Möglichkeit, eine<br />
Vielfalt von hier interessierenden Tatbeständen als gleichartiges Problem<br />
zu erfassen. Die rechtlichen Kategorien für <strong>die</strong> hier gemeinten Vorgänge<br />
sind außerordentlich vielgestaltig und erschweren somit eine m. E. erforderliche<br />
einheitliche Betrachtung. Dieser Versuch muß sich zudem sinnvollerweise<br />
auf den agrarischen Bereich der hier behandelten Territorien<br />
des alten Reichs beschränken, läßt also andere Ebenen des sozialen Konflikts<br />
wie zwischen Adel und Bürgertum, Zünften und Gesellen, Patriziat<br />
und Zünften im wesentlichen undiskutiert. 13 Das rechtfertigt sich vor allem<br />
aus der Tatsache, daß mit dem agrarischen Sektor der Lebensnerv der Territorien<br />
getroffen werden konnte, der zudem günstigere Möglichkeiten zur<br />
bedrohlichen Ausweitung von Konflikten bot, als es in den Städten der<br />
Fall sein konnte.<br />
Hauptproblem jeder Analyse sozialer Konflikte in der ständisch geord<strong>net</strong>en<br />
Gesellschaft ist <strong>die</strong> Tatsache, daß hier <strong>die</strong> Vorstellung von legitimen<br />
Auseinandersetzungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen völlig fehlte.<br />
Die Sozialordnung <strong>die</strong>ser Gesellschaft kannte Freiheiten, Privilegien, Immunitäten<br />
einerseits, Verpflichtungen und Dienste andererseits. Ihre abgestufte<br />
Verteilung und Wahrnehmung konstituierte <strong>das</strong> Grundmodell gesellschaftlicher<br />
Beziehungen im Feudalismus, <strong>das</strong> wir gewöhnlich in dem<br />
begrifflichen Dualismus von „Schutz und Schirm" und „Rat und Hilfe"<br />
erfassen. 14 Das Gleichgewicht zwischen beiden Elementen stellte im Selbstverständnis<br />
der Zeit — wenn <strong>die</strong>se vereinfachende Formel erlaubt ist —<br />
den inhaltlichen Kern der Feudalgesellschaft dar. 15 Selbstverständlich war<br />
Gesellschaft, in: B. Seidel u. S. Jenkner (Hg.), Klassenbildung und Sozialschichtung,<br />
Darmstadt 1968, S. 398-446, hier S. 434.<br />
13 Zu <strong>die</strong>sen Problemen <strong>die</strong> Überblicke bei R. Hildebrandt, Rat contra Bürgerschaft.<br />
Die Verfassungskonflikte in den Reichsstädten des 17. u. 18. Jahrhunderts, in:<br />
Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalspflege 1. 1974, S. 221<br />
bis 41 und bei H. Schultz, Soziale und politische Auseinandersetzungen in Rostock<br />
im 18. Jahrhundert, Weimar 1974, S. 11-44. Der Überblick umfaßt <strong>die</strong> Zeit zwischen<br />
dem Dreißigjährigen Krieg und der Französischen Revolution.<br />
14 Dazu vor allem 0. Brunner, Land u. Herrschaft. Grundfragen der territorialen<br />
Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Wien 1965 5, S. 263 ff. Der alleinige<br />
Rückzug auf <strong>die</strong>ses Begriffspaar würde freilich überdecken, daß auch <strong>die</strong>se<br />
Gesellschaft mit Konflikten konfrontiert wurde. Auch hier gilt <strong>die</strong> in Anm. 12<br />
zitierte Feststellung Schelskys.<br />
15 E. Wolf (Peasant warn of the 20th. century, London 1971, S. 279) spricht davon,<br />
„daß vor dem Beginn des Kapitalismus <strong>das</strong> soziale Gleichgewicht auf dem Ausgleich<br />
des Transfers des bäuerlichen Mehrwerts auf <strong>die</strong> Obrigkeit und des obrigkeitlichen<br />
Schutzes auf den Bauern" beruhte.<br />
<strong>die</strong> je konkrete Realisierung des Gleichgewichts mit dem Austragen langdauernder<br />
Konflikte verbunden. Die Ständeforschung hat deshalb der<br />
vertraglichen Absicherung der Ausgewogenheit zwischen „Schutz" und<br />
„Hilfe" in den sog. Herrschaftsverträgen und dem daraus abgeleiteten<br />
Widerstandsrecht der Stände erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet. Problematisch<br />
ist dabei freilich, daß <strong>die</strong>ses Widerstandsproblem fast ausschließlich<br />
auf der Ebene von Landesfürsten und Ständen untersucht worden<br />
ist. 16 Die Frage nach den besonderen Umständen eines Widerstandes<br />
bäuerlicher Untertanen ist demgegenüber nicht adäquat gestellt worden,<br />
auch wenn zu <strong>die</strong>ser Frage eine Reihe wichtiger Beobachtungen gemacht<br />
wurden, vor allem im Zusammenhang mit der Einordnung des Bauernkrieges<br />
von <strong>1525</strong>.17<br />
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist <strong>die</strong> These, daß seit dem 15. Jahrhundert,<br />
stärker seit dem Ausgang des Bauernkrieges, Tendenzen zu beobachten<br />
sind, <strong>die</strong>, ungeachtet der bestehenden Kriminalisierung, darauf hinauslaufen,<br />
den Konflikt zwischen Herrschaft und bäuerlichen Untertanen zu<br />
normalisieren und den beteiligten Parteien einen erweiterten Handlungsspielraum<br />
zu verschaffen, um somit <strong>die</strong> bei bewaff<strong>net</strong>en Formen der Konfliktlösung<br />
unvermeidlichen Menschen- und Sachwertverluste zu verhindern.<br />
Damit soll <strong>das</strong> präzisiert sein, was im Titel <strong>die</strong>ses Aufsatzes eher<br />
unbestimmt als <strong>die</strong> „veränderte Bedeutung sozialer Konflikte im 16. und<br />
17. Jahrhundert" angesprochen wurde.<br />
Diese These basiert auf einigen allgemeinen Rahmenbedingungen, <strong>die</strong><br />
hier zumindest in aller Kürze angeführt werden müssen. Es ist <strong>die</strong>s einmal<br />
der weiter fortschreitende Prozeß der Konsoli<strong>die</strong>rung der deutschen Territorialstaaten<br />
zum „Militär-, Wirtschafts- und Verwaltungsstaat", der in<br />
erheblich intensiverer Weise in <strong>die</strong> Beziehungen zwischen Grundherrschaften<br />
und Holden eingreifen konnte." Ist es eines der akzeptierten Charakteristika<br />
noch des spätmittelalterlichen Territoriums, eine Vielzahl quasi<br />
autonomer Rechtskreise zu umgreifen, so ändert sich <strong>das</strong> entscheidend im<br />
16 Vgl. dazu F. Hartung, Herrschaftsverträge u. ständischer Dualismus in den deutschen<br />
Territorien, in: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 10. 1952,<br />
S. 163-77 und K. Wolzendorff, Staatsrecht u. Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht<br />
des Volkes gegen rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt, Breslau<br />
1916 (Neudr. Aalen 1961).<br />
17 Hinzuweisen wäre hier auf Otto Brunners Überlegungen (Land u. Herrschaft,<br />
S. 343 ff., besonders S. 347 f.) zur veränderten Bedeutung der grundherrlichen<br />
Schutzgewalt, „<strong>die</strong> ihren Sinn zu verlieren beginnt, <strong>die</strong> der werdende moderne<br />
Staat übernimmt." — Insgesamt zu <strong>die</strong>ser Fragestellung Blickle, Revolution, der<br />
eine abgewogene Einordnung des Bauernkrieges in <strong>die</strong> agrarische, staatliche und<br />
religiöse Entwicklung des frühen 16. Jahrhunderts leistet.<br />
18 Der Begriff nach G. Oestreichs Klassifizierung in: Ständetum u. Staatsbildung,<br />
zuletzt in: H. Rausch (Hg.), Die geschichtlichen Grundlagen der modernen Volksvertretung,<br />
Darmstadt 1974, S. 47-62, hier S. 57 ff., obwohl Oestreich <strong>die</strong>se Funktion<br />
nicht ausdrücklich erwähnt.