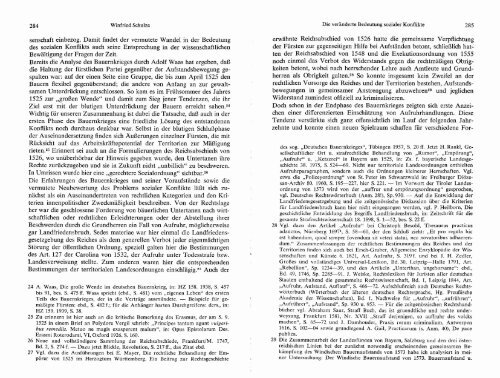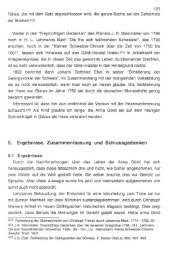1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
1525 das Domkapitel die beibehaltenen Neuerungen - Historicum.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
284 Winfried Schulze Die veränderte Bedeutung sozialer Konflikte 285<br />
senschaft einbezog. Damit findet der vermutete Wandel in der Bedeutung<br />
des sozialen Konflikts auch seine Entsprechung in der wissenschaftlichen<br />
Bewältigung der Fragen der Zeit.<br />
Bereits <strong>die</strong> Analyse des Bauernkrieges durch Adolf Waas hat ergeben, daß<br />
<strong>die</strong> Haltung der fürstlichen Partei gegenüber der Aufstandsbewegung gespalten<br />
war: auf der einen Seite eine Gruppe, <strong>die</strong> bis zum April <strong>1525</strong> den<br />
Bauern flexibel gegenüberstand; <strong>die</strong> andere von Anfang an zur gewaltsamen<br />
Unterdrückung entschlossen. So kam es im Frühsommer des Jahres<br />
<strong>1525</strong> zur „großen Wende" und damit zum Sieg jener Tendenzen, <strong>die</strong> ihr<br />
Ziel erst mit der blutigen Unterdrückung der Bauern erreicht sahen.24<br />
Wichtig für unseren Zusammenhang ist dabei <strong>die</strong> Tatsache, daß auch in der<br />
ersten Phase des Bauernkrieges eine friedliche Lösung des entstandenen<br />
Konflikts noch durchaus denkbar war. Selbst in der blutigen Schlußphase<br />
der Auseinandersetzung finden sich Äußerungen einzelner Fürsten, <strong>die</strong> mit<br />
Rücksicht auf <strong>das</strong> Arbeitskräftepotential der Territorien zur Mäßigung<br />
rieten. 25 Erinnert sei auch an <strong>die</strong> Formulierungen des Reichsabschieds von<br />
1526, wo unüberhörbar der Hinweis gegeben wurde, den Untertanen ihre<br />
Rechte zurückzugeben und sie in Zukunft nicht „unbillich" zu beschweren.<br />
In Umrissen wurde hier eine „gerechtere Sozialordnung" sichtbar.26<br />
Die Erfahrungen des Bauernkrieges und seiner Voraufstände sowie <strong>die</strong><br />
vermutete Neubewertung des Problems sozialer Konflikte läßt sich zunächst<br />
als ein Auseinandertreten von rechtlichen Kategorien und den Kriterien<br />
innenpolitischer Zweckmäßigkeit beschreiben. Von der Rechtslage<br />
her war <strong>die</strong> geschlossene Forderung von bäuerlichen Untertanen nach wirtschaftlichen<br />
oder rechtlichen Erleichterungen oder der Abstellung ihrer<br />
Beschwerden durch <strong>die</strong> Grundherren ein Fall von Aufruhr, möglicherweise<br />
gar Landfriedensbruch. Sedes materiae war hier einmal <strong>die</strong> Landfriedensgesetzgebung<br />
des Reiches als dem generellen Verbot jeder eigenmächtigen<br />
Störung der öffentlichen Ordnung, speziell galten hier <strong>die</strong> Bestimmungen<br />
des Art. 127 der Carolina von 1532, der Aufruhr unter Todesstrafe bzw.<br />
Landesverweisung stellte. Zum anderen waren hier <strong>die</strong> entsprechenden<br />
Bestimmungen der territorialen Landesordnungen einschlägig. 27 Auch der<br />
24 A. Waas, Die große Wende im deutschen Bauernkrieg, in: HZ 158. 1938, S. 457<br />
bis 91, bes. S. 475 ff. Waas spricht (ebd., S. 481) vom „eigenen Leben" des ersten<br />
Teils des Bauernkrieges, der in <strong>die</strong> Verträge ausmündete. — Beispiele für gemäßigte<br />
Fürsten: ebd., S. 482 f.; für <strong>die</strong> Anhänger harten Durchgreifens: ders., in:<br />
HZ 159. 1939, S. 38.<br />
25 Zu erinnern ist hier auch an <strong>die</strong> kritische Bemerkung des Erasmus, der am 5. 9.<br />
<strong>1525</strong> in einem Brief an Polydore Vergil schrieb: „Principes tantum agunt vulgaribus<br />
remediis. Metuo ne magis exasperent malum", in: Opus Epistolarum Des.<br />
Erasmi Roterodami, VI, Oxford 1926, S. 160.<br />
26 Neue und vollständigere Sammlung der Reichsabschiede, Frankfurt/M. 1747,<br />
Bd. 2, S. 274 f. — Dazu jetzt Blickle, Revolution, S. 217 ff., <strong>das</strong> Zitat ebd.<br />
27 Vgl. dazu <strong>die</strong> Ausführungen bei E. Mayer, Die rechtliche Behandlung der Empörer<br />
von <strong>1525</strong> im Herzogtum Württemberg. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte<br />
erwähnte Reichsabschied von 1526 hatte <strong>die</strong> gemeinsame Verpflichtung<br />
der Fürsten zur gegenseitigen Hilfe bei Aufständen betont, schließlich hatten<br />
der Reichsabschied von 1548 und <strong>die</strong> Exekutionsordnung von 1555<br />
noch einmal <strong>das</strong> Verbot des Widerstands gegen <strong>die</strong> rechtmäßigen Obrigkeiten<br />
betont, wobei nach herrschender Lehre auch Amtleute und Grundherren<br />
als Obrigkeit galten. 28 So konnte insgesamt kein Zweifel an der<br />
rechtlichen Vorsorge des Reiches und der Territorien bestehen, Aufstandsbewegungen<br />
in gemeinsamer Anstrengung abzuwehren 29 und jeglichen<br />
Widerstand zumindest offiziell zu kriminalisieren.<br />
Doch schon in der Endphase des Bauernkrieges zeigten sich erste Anzeichen<br />
einer differenzierten Einschätzung von Aufruhrhandlungen. Diese<br />
Tendenz verstärkte sich ganz offensichtlich im Lauf der folgenden Jahrzehnte<br />
und konnte einen neuen Spielraum schaffen für verschiedene For-<br />
des sog. „Deutschen Bauernkrieges", Tübingen 1957, S. 20 ff. Jetzt H. Rankl, Gesellschaftlicher<br />
Ort u. strafrechtliche Behandlung von „Rumor", „Empörung",<br />
„Aufruhr" u. „Ketzerei" in Bayern um <strong>1525</strong>, in: Zs. f. bayerische Landesgeschichte<br />
38. 1975, 5.524-69. Nicht nur territoriale Landesordnungen enthielten<br />
Aufruhrparagraphen, sondern auch <strong>die</strong> Ordnungen kleinerer Herrschaften. Vgl.<br />
etwa <strong>die</strong> „Policeyordnung" von St. Peter im Schwarzwald in: Freiburger Diözesan-Archiv<br />
80. 1960, S. 195-227, hier S. 221. — Im Vorwort der Tiroler Landesordnung<br />
von 1573 wird von der „auffrur und empörungsordnung" gesprochen,<br />
vgl. Deutsches Rechtswörterbuch (Anm. 28!), Sp. 930. — Auf <strong>die</strong> Entwicklung der<br />
Landfriedensgesetzgebung und <strong>die</strong> zeitgenössische Diskussion über <strong>die</strong> Kriterien<br />
für Landfriedensbruch kann hier nicht eingegangen werden, vgl. P. Heilborn, Die<br />
geschichtliche Entwicklung des Begriffs Landfriedensbruch, in: Zeitschrift für <strong>die</strong><br />
gesamte Strafrechtswissenschaft 18. 1898, S. 1-52, bes. S. 22 ff.<br />
28 Vgl. dazu den Artikel „Aufruhr" bei Christoph Besold, Thesaurus practicus<br />
adauctus, Nürnberg 16974, S. 58-60, der den Schluß zieht: „Et pro regula hic<br />
est habendum, quod semper fovendum sit veteri statui, nec novatoribus adhaerendum."<br />
Zusammenfassungen der rechtlichen Bestimmungen des Reiches und der<br />
Territorien finden sich auch bei Ersch-Gruber, Allgemeine Enzyklopä<strong>die</strong> der Wissenschaften<br />
und Künste 6. 1821, Art. Aufruhr, S. 319 f. und bei J. H. Ze<strong>die</strong>r,<br />
Großes und vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 30, Leipzig—Halle 1791, Art.<br />
„Rebellion", Sp. 1234-39, und den Artikeln „Unterthan, ungehorsame": ebd.,<br />
Bd. 49, 1746, Sp. 2285-91. J. Weiske, Rechtslexikon für Juristen aller deutschen<br />
Staaten enthaltend <strong>die</strong> gesammelte Rechtswissenschaft, Bd. 1, Leipzig 1844, Art.<br />
„Aufruhr, Aufstand, Auflauf", S. 466-72. Aufschlußreich auch Deutsches Rechtswörterbuch<br />
(Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache, Hg. Preußische<br />
Akademie der Wissenschaften), Bd. 1, Nachweise für „Aufruhr", „aufrühren",<br />
„Aufrührer", „Aufstand", Sp. 930 u. 953. — Für <strong>die</strong> zeitgenössischen Rechtshandbücher<br />
vgl. Abraham Saur, Straff Buch, <strong>das</strong> ist gruendtliche und rechte underweysung,<br />
Frankfurt 1581, Nr. XVII „Straff derjenigen, so auffruhr des volcks<br />
machen", S. 65-72 und J. Damhouder, Praxis rerum criminalium, Antwerpen<br />
1616, S. 102-04 sowie grundlegend A. Gail, Practicarum (s. Anm. 40), De pace<br />
publica.<br />
29 Die Zusammenarbeit der Landesfürsten von Bayern, Salzburg und den drei österreichischen<br />
Linien bei der zunächst notwendig erscheinenden gemeinsamen Bekämpfung<br />
des Windischen Bauernaufstands von 1573 habe ich analysiert in meiner<br />
Untersuchung: Der Windische Bauernaufstand von 1573. Bauernaufstand u.