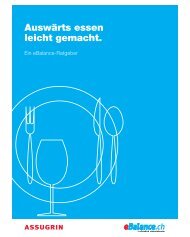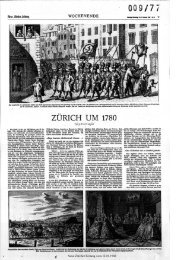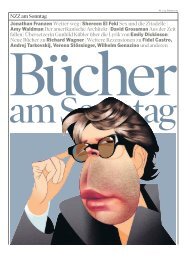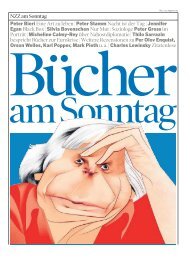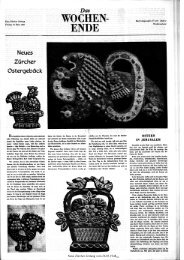Marlene Dietrich - Leni Riefenstahl Doppelbiografie - Neue Zürcher ...
Marlene Dietrich - Leni Riefenstahl Doppelbiografie - Neue Zürcher ...
Marlene Dietrich - Leni Riefenstahl Doppelbiografie - Neue Zürcher ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Porträt<br />
Die israelische Soziologin Eva Illouz hat ein grossartiges Buch über<br />
Beziehungen zwischen Männern und Frauen im 21. Jahrhundert<br />
geschrieben. Jenny Friedrich-Freksa hat sie in Frankfurt getroffen<br />
Auf dem freien<br />
Markt der Liebe<br />
Es ist nicht leicht, in einer zwei mal zwei Meter<br />
grossen Box über die Liebe zu sprechen. Eva<br />
Illouz sitzt auf einem weissen Stuhl vor einem<br />
weissen Tisch. Von der offenen Decke dringt<br />
das Geraune der Frankfurter Buchmesse in das<br />
Hinterzimmer des Verlagsstands herein. Die<br />
Soziologin aus Jerusalem ist hier, um über das<br />
Lieben und das Leiden zu reden, das Thema<br />
ihres neuen Buchs «Warum Liebe weh tut». Sie<br />
untersucht darin, wie Männer und Frauen ihr<br />
eigenes Leben gestalten und Liebesbeziehungen<br />
mit anderen Menschen haben. Beides zu<br />
wollen ist offenbar schwierig. Es verursacht<br />
sogar Schmerz. Über diesen denkt Illouz nach.<br />
Schmerz und Leidenschaft<br />
Das Buch scheint einen Nerv zu treffen. In<br />
Deutschland, wo es im Oktober erschien, steht<br />
es bereits auf der Bestsellerliste. Alle wollen<br />
wissen, was Eva Illouz über unser Gefühlsleben<br />
herausgefunden hat. Als ob der Buchmarkt<br />
nicht mit Büchern über die Liebe überschwemmt<br />
wäre. «Eine soziologische Erklärung»<br />
nennt Illouz ihre Schrift. Von aussen<br />
sieht diese Erklärung aus wie ein Beziehungsratgeber<br />
für die etwas klügere Frau: Der Umschlag<br />
magentafarben, also fast pink. Und auf<br />
der Rückseite steht: «Leidenschaftliche Liebe<br />
ist ohne Schmerz nicht zu haben, aber dieser<br />
Schmerz sollte uns nicht ängstigen.» Ach ja.<br />
Soll man dieses Buch kaufen? Man sollte, unbe-<br />
Eva Illouz<br />
Eva Illouz, geboren 1961 in<br />
Fès, Marokko, studierte in<br />
Frankreich, promovierte in den<br />
USA und ist heute Professorin<br />
für Soziologie an der Hebrew<br />
University in Jerusalem. Sie<br />
forscht zu den Wechselwirkungen<br />
von Konsumkultur,<br />
sozialen Beziehungen und<br />
Individuum und zur Soziologie<br />
der Emotionen. Bisher sind<br />
von ihr erschienen: «Der Konsum der Romantik»<br />
(2003), «Gefühle in Zeiten des Kapitalismus»<br />
(2006), «Die Errettung der modernen Seele»<br />
(2009) und nun: «Warum Liebe weh tut»<br />
(Suhrkamp, Berlin 2011. 467 Seiten, Fr. 35.60).<br />
16 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. November 2011<br />
dingt. Illouz’ Werk ist weder mit Theorie überfrachtet,<br />
noch will es eine Gebrauchsanweisung<br />
für das gelungene Leben zu zweit liefern. Es ist<br />
ein Buch über die Liebe, das ganz ohne psychologisches<br />
Geschwätz auskommt. Und gleichzeitig<br />
Gefühlen in der Wissenschaft einen selbstverständlichen<br />
Platz einräumt.<br />
Illouz hat für ihr Buch viele Interviews geführt:<br />
mit heterosexuellen Männern und Frauen<br />
zwischen 25 und 67 Jahren, aus Europa, den<br />
Es ist ein echter Gewinn des<br />
Buchs, dass Männer nicht als<br />
emotionale Trottel und<br />
Frauen nicht als bessere<br />
Menschen gesehen werden.<br />
USA und Israel, alle mit Hochschulabschluss.<br />
Ein Gespräch ist ihr besonders in Erinnerung<br />
geblieben: «Eine Frau erzählte, dass ihre Beziehungen<br />
alle schlecht geendet hatten. Sie würde<br />
so gerne heiraten, aber es sei ihr peinlich, das<br />
zuzugeben. Man stünde dann als dumme Frau<br />
da. Sie weinte furchtbar und ich spürte, dass<br />
man sich diesen Schmerz ansehen muss. Wenn<br />
jemand so weint, ist das nicht einfach eine persönliche<br />
Angelegenheit. Es ist politisch.»<br />
Sehr ernst spricht Eva Illouz in der sterilen<br />
Messebox über das Seelenwohl anderer Menschen.<br />
Sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr<br />
das Thema ihres Buchs ein echtes Anliegen ist.<br />
Vor allem: dass Leid nicht privat sein sollte. Illouz<br />
ist eine zierliche Frau. Ab und zu zupft sie<br />
den tiefen Ausschnitt ihrer Bluse zurecht, der<br />
von grossen Silbernieten eingefasst ist. Die<br />
Bluse ist schwarz, der Rock und die Schuhe<br />
auch. Doch über das Schwarz und das Metall-<br />
Dekolletee hinweg schauen einen zwei weiche,<br />
braune Augen an, manchmal betrübt, manchmal<br />
amüsiert. Eva Illouz hat etwas von einem<br />
freundlichen Punk, der gewillt ist, die Welt aus<br />
unkonventioneller Perspektive zu betrachten.<br />
Unkonventionell an ihrem Buch ist, wie die<br />
Soziologin soziologische, ökonomische und<br />
psychologische Erkenntnisse zusammendenkt.<br />
Dass es mit der Liebe klappt, wenn wir uns nur<br />
genug mit unserer Psyche auseinandersetzen,<br />
daran glaubt Illouz nicht. Sie hält Psychotherapien<br />
für hilfreich, aber nicht für ein Allheilmit-<br />
tel. Anders gesagt: die weinende, von den Männern<br />
enttäuschte Frau, die unbedingt heiraten<br />
will, müsste nicht einfach zum Therapeuten.<br />
Wenn zu viele Menschen die gleichen Beziehungsprobleme<br />
haben – so ihr Befund –, reicht<br />
es nicht, dass jeder sich allein mit seinem Gefühlsleben<br />
beschäftigt.<br />
Die Soziologin analysiert Liebesbeziehungen<br />
als ökonomischen Handel, als einen Markt, auf<br />
dem sich Männer und Frauen tummeln. Attraktivität<br />
und Status sind die beiden Währungen,<br />
die am meisten zählen. Auf den ersten Blick<br />
scheint es, als seien Männer und Frauen auf<br />
diesem Markt gleichberechtigt. Beide Geschlechter<br />
haben schliesslich heute die gleiche<br />
Freiheit zu wählen. Doch Illouz konstatiert eine<br />
neue Ungleichheit: «Die heterosexuellen Frauen<br />
der Mittelschicht befinden sich in der merkwürdigen<br />
historischen Lage, so souverän über<br />
ihren Körper und ihre Gefühle verfügen zu<br />
können wie nie zuvor und dennoch auf neue<br />
und nie dagewesene Weise von Männern dominiert<br />
zu werden.»<br />
Emotionale Dominanz der Männer<br />
Illouz spricht von einer «emotionalen Dominanz»<br />
der Männer, die zum einen darauf beruht,<br />
dass Frauen, wenn sie sich Kinder wünschen,<br />
nicht ewig warten können, bis sie sich<br />
für einen Mann entscheiden. Das macht sie auf<br />
dem freien Markt der Liebe abhängiger. Zum<br />
anderen stärken Männer ihr Selbstwertgefühl<br />
durch Unabhängigkeit, während Frauen sich<br />
ihrer selbst durch Nähe vergewissern – zwei<br />
völlig verschiedene Strategien, um sich vor<br />
emotionalen Verletzungen zu schützen.<br />
Illouz behauptet nicht, dass sich alle Männer<br />
und Frauen so einfach kategorisieren lassen.<br />
Doch sie stellt in ihrer Forschung wiederkehrende<br />
Verhaltensmuster fest und kulturelle Ideale,<br />
die definieren, was einen Mann und was<br />
eine Frau ausmacht: «George Clooney ist ein<br />
attraktiver Single, genauso attraktiv wie Brad<br />
Pitt, der verheiratet ist. Bei unverheirateten<br />
Frauen im selben Alter denkt man, sie hätten<br />
keinen abgekriegt.» Es ist ein echter Gewinn<br />
des Buchs, dass Männer nicht als emotionale<br />
Trottel pathologisiert und Frauen nicht für die<br />
besseren Menschen gehalten werden.<br />
Eva Illouz ist 50, sie hat einen Mann und drei<br />
Söhne. Über die Frage, ob man sie als Leser anders<br />
wahrnehmen würde, wenn sie allein leben<br />
würde, muss sie lächeln: «Völlig richtig. Alle