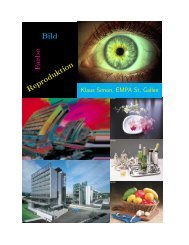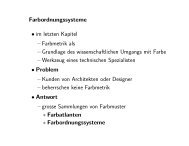Kapitel 4 Farbmetrik - EMPA Media Technology
Kapitel 4 Farbmetrik - EMPA Media Technology
Kapitel 4 Farbmetrik - EMPA Media Technology
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4.2. Der RGB-Farbraum 51<br />
4.2 Der RGB-Farbraum<br />
Der nächste Schritt zur <strong>Farbmetrik</strong> besteht nun in der Auswahl geeigneter Basisvektoren,<br />
den sogenannten Primärvalenzen. Auf Grund der effektiven physikalischen Realisierbarkeit<br />
bietet sich eine Basis aus roten, grünen und blauen Farbvalenzen an. Andererseits<br />
sollte die exakte Festlegung allgemein anerkannt, d.h. standardisiert sein. Die heute gebräuchliche<br />
Definition des RGB-Farbraumes stammt aus dem Jahr 1931 und wurde von<br />
der CIE [2] vorgenommen. Sie legte die Primärfarben R, G und B als die Spektralfarben<br />
der Wellenlänge<br />
• 700.0 nm (R)<br />
• 546.1 nm (G)<br />
• 435.8 nm (B)<br />
fest. Die entsprechenden Intensitäten sind so bestimmt, dass die Summe der Primärfarben<br />
Unbunt U ergibt, d.h. die Farbart des unzerlegten energiegleichen Spektrums, also:<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
500<br />
R + G + B = U (4.7)<br />
525<br />
546.1nm<br />
550<br />
438.8nm<br />
600<br />
700nm<br />
−0.5<br />
−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5<br />
Abbildung 4.8: die 2D-Standarddarstellung des RGB-Raums<br />
Zur graphischen Darstellung dreidimensionaler Farbräume verwendet man jedoch seit<br />
Newton zweidimensionale Reduktionen in Form von Farbkreisen oder -dreiecken. Im Wesentlichen<br />
bedeutet dies, dass die Länge des Farbvektors nicht dargestellt wird. Zunächst<br />
475<br />
575