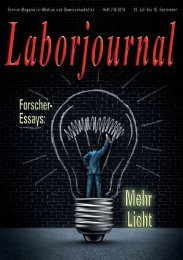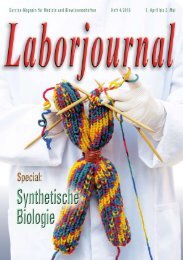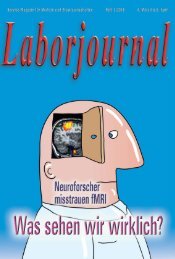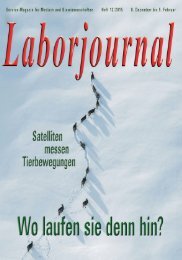LJ_15_11
LJ_15_11
LJ_15_11
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hintergrund<br />
Illustr.: slate.com<br />
Antwort auf den Essay „Eltern gehören unterstützt, nicht abgelehnt“<br />
von Martin Ballaschk (Laborjournal 7-8/20<strong>15</strong>: 28-30)<br />
Halbtagswissenschaftler<br />
bringen‘s einfach nicht!<br />
Wie sicherlich viele „Betroffene“ hatte ich nach dem Lesen<br />
des Essays von Martin Ballaschk in der Sommerausgabe des Laborjournals<br />
eine Nackenstarre vom eifrigen Kopfnicken: „Eltern<br />
gehören unterstützt, nicht abgelehnt.“ Wie wahr, wie wahr.<br />
Seit 16 Jahren spiele ich nun fleißig mit im Zirkus der<br />
Wissenschaften, zunächst als Technische Assistentin, nach dem<br />
Biostudium auf einer Promotionsstelle und inzwischen als Postdoc<br />
an der schönen Universität zu Münster. Achja, und nebenher<br />
habe ich auch noch eine Familie gegründet. Verrückte Idee.<br />
Meine Tochter ist inzwischen sieben Jahre alt und kam während<br />
der Promotion zur Welt. Kühn wie ich damals war, nahm<br />
ich nach dem Ende des Mutterschutzes noch<br />
vier Wochen Elternzeit, um anschließend in<br />
Doktoranden-Standard-Übervollzeit an die<br />
Laborbench zurückzukehren. Mein maximal-emanzipierter<br />
Partner nahm elf Monate<br />
Elternzeit (Ja, liebe Väter – auch ihr dürft<br />
mehr als die zwei Monate Alibi-Elternzeit nehmen), bevor das<br />
Töchterchen in der institutseigenen Kita teilzeitbetreut wurde.<br />
In dieser Zeit habe ich sie abends vielleicht eine, mal sogar zwei<br />
Stunden gesehen – und das auch nur, weil ich jeden Morgen<br />
gegen sechs Uhr das Haus gen Arbeit verließ, um nachmittags<br />
„eher“ gehen zu können. Fakt ist: Mein Mann hat unsere Tochter<br />
die ersten zwei Jahre ihres Lebens alleine aufgezogen.<br />
Inzwischen ist die Familie um zwei weitere Zwerge angewachsen,<br />
und die Eltern teilen sich total demokratisch eineinhalb<br />
Stellen. Nebenbei – also, abends und nachts – arbeite ich<br />
noch an meiner Alternativkarriere, denn Wissenschaftszeitvertragsgesetz<br />
sei Dank tickt nach dem gefühlt 3.000-sten Zeitvertrag<br />
meine Academia-Uhr unaufhörlich runter.<br />
Alle Kinder sind in Ganztagsbetreuungsformen untergebracht<br />
und werden zwischen <strong>15</strong> und 16 Uhr in die Obhut ihrer<br />
natürlich immer tiefenentspannten Vorzeigeeltern entlassen.<br />
Stress? Wo? Ist doch alles super geregelt, oder etwa nicht?<br />
Welche akademischen Supereltern kennen es nicht: dieses<br />
erdrückende Gefühl in der Brust, der auf über 200 Schläge pro<br />
Minute hochschnellende Puls, wenn du mit<br />
der Pipette in der Hand und dem unerbittlich<br />
herabzählenden Timer vor dir aus dem<br />
Augenwinkel die Meldung „Kita ruft an“<br />
auf dem immer parat liegenden Mobiltelefon<br />
siehst. Vor dem geistigen Auge laufen<br />
die letzten Tage ab, in denen du dich genau auf diesen Versuch<br />
vorbereitet hast – immer im Hinterkopf, dass du bei Misslingen<br />
mehrere hundert Euro in den Sand setzt. Und dann erklärt die<br />
Stimme am anderen Ende: „Tut mir wirklich leid, aber dein<br />
Kind hat 39°C Fieber, kotzt uns die Bude voll und ist auch eher<br />
übellaunig.“ Du weißt, es tut der Erzieherin wirklich leid, und<br />
du weißt, deinem Kind geht es wirklich schlecht – und du weißt<br />
auch: Wenn du jetzt gehst, war mal wieder alles umsonst. Du<br />
„Ich dachte immer,<br />
Familienförderung habe<br />
etwas mit Familie zu tun.“<br />
„Glauben die, dass mein Hirn<br />
komplett herunterfährt, wenn<br />
ich das Labor verlasse?“<br />
bettelst um wenigstens 20 Minuten, der Timer piept, du hastest<br />
zum Platz, fegst dabei die Pipette mit der wertvollen Reagenz<br />
vom Tisch, die Spitze springt ab, die Tropfen verteilen sich im<br />
Raum... Du schluckst und sagst: „Okay, bin in fünf Minuten da.“<br />
Und wenn ich dann meinen Jüngsten im Arm habe, er mich mit<br />
verrotzer Nase und verheulten Augen anstrahlt, ist es vergessen,<br />
dann ist alles okay, so wie es ist. Dann fühlt es sich richtig an.<br />
Jammern? Will ich nicht. Es war meine und unsere Entscheidung.<br />
Und ich hatte und habe das große Glück, mit meinen familiären<br />
Plänen bei Vorgesetzten und Kollegen auf viel Verständnis<br />
und Rückhalt gestoßen zu sein. Dazu spielt die gelobte zeitliche<br />
Flexibilität der akademischen Forschung auch<br />
eine erhebliche Rolle. Also, alles in Butter? Ja,<br />
im Großen und Ganzen schon...<br />
ABER – und ich komme nun auf den<br />
Essay von Martin Ballaschk zurück: Eines<br />
muss ich los werden! Herr Ballaschk lobt<br />
die Bemühungen der Familienförderung in der Wissenschaft<br />
und führt an: „Im EU-Forschungsrahmenprogramm werden<br />
erfolgreiche Frauen mit einem „Innovators Prize“ bedacht, die<br />
Robert-Bosch-Stiftung und die Nüsslein-Volhard (CNV)-Stiftung<br />
fördern gezielt Frauen oder Frauen mit Kindern.“<br />
Haben Sie sich mal darüber informiert, was die CNV-Stiftung<br />
unter Familienförderung versteht? Unter www.cnv-stiftung.de<br />
kann man es nachlesen. Eingangs heißt es noch recht unverfänglich:<br />
„Die im Jahre 2004 gegründete Stiftung zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung unterstützt begabte junge Wissenschaftlerinnen<br />
mit Kindern, um ihnen die für eine wissenschaftliche<br />
Karriere erforderliche Freiheit und Mobilität zu verschaffen.<br />
Die Stiftung will helfen zu verhindern, dass hervorragende<br />
Talente der wissenschaftlichen Forschung verloren gehen.“<br />
Ein hehres Ziel und ein nobler Gedanke. Es wird im Folgenden<br />
recht klar definiert, wofür die monatliche Förderung von<br />
200 bis 400 Euro eingesetzt werden sollte (die man übrigens nur<br />
erhält, wenn die Vollzeitbetreuung des Nachwuchses gewährleistet<br />
ist): „Die finanzielle Unterstützung soll zur Entlastung<br />
im Haushalt und bei der Kinderbetreuung<br />
beitragen, um Zeit für die wissenschaftliche<br />
Arbeit zu gewinnen. Diese Mittel können<br />
zum Beispiel zur Einstellung von Haushaltshilfen,<br />
Anschaffung von Geräten wie Spüloder<br />
Waschmaschine und für zusätzliche<br />
Kinderbetreuung verwendet werden (zum Beispiel Babysitter in<br />
den Abendstunden oder während Reisen zu Tagungen).“<br />
Auch das, alles noch voll in Ordnung. Wenn jemand das so<br />
möchte, soll er – beziehungsweise sie – das so machen. Sie alle<br />
haben meinen Segen.<br />
Doch dann… ein Rückfall in die Vorsteinzeit. Nach einigem<br />
Geschwafel, dass die „Wissenschaft […] ein sehr anspruchsvoller<br />
und besonderer Beruf“ sei, der einen „10- bis 14-Stun-<br />
18<br />
<strong>11</strong>/20<strong>15</strong> Laborjournal