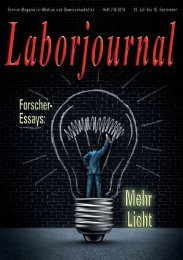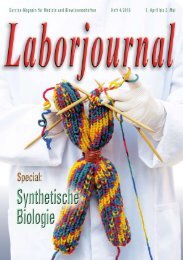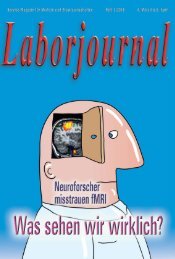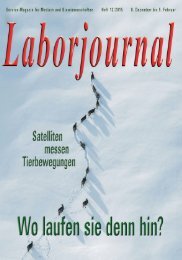LJ_15_11
LJ_15_11
LJ_15_11
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Journal Club<br />
Chemische Ökologie in Stuttgart<br />
Ein Schnellkäfer der<br />
Art Idolus picipennis.<br />
Ähem,... sicher?<br />
Eigen-artiger<br />
Käferduft<br />
Foto: Christian König<br />
Im Schwarzwald gingen<br />
Schnellkäfer der Art Idolus picipennis<br />
in die Pheromonfallen<br />
Hohenheimer Entomologen, in<br />
Schwaben hingegen blieben<br />
sie leer. Der Grund: Die beiden<br />
äußerlich sehr ähnlichen<br />
Käferpopulationen gehören zu<br />
verschiedenen Arten, die auf<br />
unterschiedliche Sexualpheromone<br />
reagieren.<br />
Sexualpheromone sind Botenstoffe, die<br />
Paarungspartner anlocken. Vor allem bei<br />
Insekten spielen sie eine wichtige Rolle.<br />
Hat man die chemische Struktur dieses<br />
Kommunikationsmittels identifiziert, kann<br />
man das Pheromon auch synthetisch erzeugen<br />
und seine Lockwirkung nutzen, um<br />
die ahnungslosen Tiere einzufangen. Eine<br />
Pheromonfalle befreit den Kleider- oder<br />
Küchenschrank von Motten. Im größeren<br />
Stil kann man damit auch Schädlinge wie<br />
etwa Drahtwürmer vom Acker fernhalten.<br />
Drahtwürmer sind keine Würmer im<br />
eigentlichen Sinne, sondern die Larven<br />
des Schnellkäfers. Ihren Namen tragen<br />
Schnellkäfer nicht etwa, weil sie schnell<br />
laufen können. Vielmehr besitzen sie einen<br />
Sprungapparat, mit dem sie bei Gefahr<br />
hoch in die Luft schnellen. So können sie<br />
sich beispielsweise aus dem Schnabel eines<br />
Vogels befreien.<br />
Gefürchtete Arten<br />
Unter Landwirten sind einige Schnellkäferarten<br />
gefürchtet. Ihre Larven fressen<br />
die Wurzeln von Getreidepflanzen, Kartoffeln,<br />
Erdbeeren, Salat, Spargel, Zwiebeln,<br />
Gurken, Tomaten, Zuckerrüben und<br />
so weiter. Fängt man die adulten Tiere mit<br />
Pheromonfallen, bleibt auch der gefräßige<br />
Nachwuchs aus – und zwar ganz ohne den<br />
Einsatz von Insektiziden.<br />
30<br />
Christian König beim<br />
gaschromatographischen<br />
Pheromonbestimmen<br />
Foto: Anna-Lena Krause<br />
Doch nicht alle Schnellkäferarten sind<br />
Schädlinge. Von den weltweit rund 10.000<br />
Arten kommen etwa 180 in Deutschland<br />
vor. Darunter auch sehr seltene, besonders<br />
schützenswerte, über die nur wenig<br />
bekannt ist. An diesen Arten forschen die<br />
Tierökologen der Universität Hohenheim<br />
unter der Leitung von Johannes Steidle.<br />
Doch wie kann man das Vorkommen der<br />
teilweise nur wenige Millimeter kleinen,<br />
seltenen Käfer erfassen und überwachen?<br />
Die Schnellkäferart Idolus picipennis<br />
lebt bevorzugt auf Büschen in der Nähe<br />
von Blockhalden – das sind Ansammlungen<br />
großer Steine, die man beispielsweise<br />
in den Alpen, im Voralpenland und im<br />
Schwarzwald findet. Damit man die Tierchen<br />
nicht mühevoll im Gestrüpp auf felsigem<br />
Untergrund einsammeln muss, sind<br />
Fallen mit künstlichen Pheromonen praktische<br />
Hilfsmittel. Till Tolasch und seine<br />
Hohenheimer Arbeitsgruppe „Pheromone“<br />
nutzten sie, um das Vorkommen von Idolus<br />
picipennis im Schwarzwald sowie die<br />
Spezifität der Pheromone zu untersuchen.<br />
Dies gelang den Biologen so gut, dass<br />
sie befürchteten, durch weitere Pheromonfallenversuche<br />
der Population der seltenen<br />
Käfer in diesem Gebiet zu schaden.<br />
„Wir wussten auch von Sammlern, dass<br />
sie nur selten gefangen werden“, erzählt<br />
Tolaschs Kollege Christian<br />
König. Deshalb wichen sie<br />
für weitere Versuche auf die<br />
schwäbische Alb aus. Doch<br />
obwohl sie genau wussten,<br />
dass auch dort Schnellkäfer<br />
dieser Art vorkommen, blieben<br />
die Pheromonfallen am<br />
zweiten Standort leer.<br />
Um der mangelnden<br />
Anziehungskraft des Duftstoffes<br />
am schwäbischen<br />
Standort auf den Grund zu<br />
gehen, sammelten die Forscher<br />
dort einige Weibchen ein. Weibliche<br />
Schnellkäfer der Unterfamilie Elaterinae<br />
tragen an ihrem Legeapparat zwei kleine<br />
Pheromonreservoire. Diese präparierten<br />
die Forscher vorsichtig ab und lösten den<br />
Inhalt in Dichlormethan. Mittels gekoppelter<br />
Gaschromatographie/Massenspektrometrie<br />
(GC-MS) analysierten sie anschließend<br />
die chemische Zusammensetzung des<br />
Lockstoffes. „Und die war komplett anders<br />
als bei den Tieren, die im Schwarzwald<br />
leben“, betont König. Ein einziges Insekt<br />
reicht heute aus, um die chemische Zusammensetzung<br />
seines Lockstoffes zu identifizieren.<br />
Das war vor über 65 Jahren, als<br />
das erste Pheromon strukturell aufgeklärt<br />
wurde, noch undenkbar: Der deutsche Biochemiker<br />
Adolf Butenandt benötigte 1959<br />
dafür etwa 500.000 Seidenspinnerweibchen<br />
(Bombyx mori), aus deren Abdominaldrüsen<br />
er nach über 20 Jahren Forschung<br />
<strong>15</strong> mg flüssiges Pheromon isolierte.<br />
Farnesyl- statt Nerylverbindungen<br />
Die Hohenheimer Entomologen benötigten<br />
viel weniger Exemplare um herauszufinden,<br />
dass die Schnellkäfer aus dem<br />
Schwarzwald ganz andere Pheromone bilden<br />
als die Vertreter von der schwäbischen<br />
Alb: Während erstere sich von einer Mi-<br />
<strong>11</strong>/20<strong>15</strong> Laborjournal