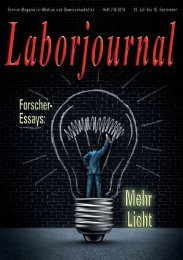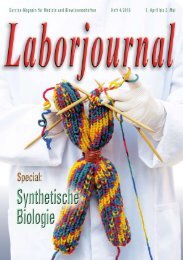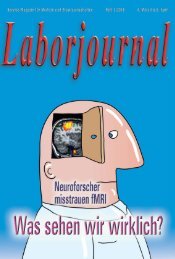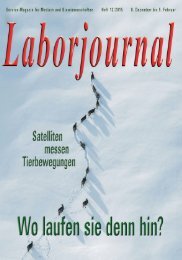LJ_15_11
LJ_15_11
LJ_15_11
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Editorial<br />
Kaum ein Begriff ist zuletzt von Forschungspolitikern und<br />
-funktionären so inflationär verwendet worden wie „Exzellenz“.<br />
So starteten etwa Bund und Länder vor zehn Jahren eine<br />
milliardenschwere gleichnamige Initiative zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen. Was<br />
sie seitdem gebracht hat, kann man bisher kaum schlüssig<br />
beurteilen. Immerhin weist das „Times Higher Education World<br />
University Ranking 2014-<strong>15</strong>“ gleich neun deutsche Universitäten<br />
unter den hundert Top-Universitäten weltweit aus. Nie zuvor<br />
schafften es so viele in solch exzellente Höhen dieses Rankings.<br />
Und völlig klar, dass unsere Forschungspolitiker diese Entwicklung<br />
reflexartig als Erfolg der „Exzellenzinitiative“ verkaufen.<br />
Aber sind die entsprechenden Hochschulen jetzt tatsächlich<br />
„exzellent“? (Übrigens gelangten in den „Life Sciences“ nur<br />
noch vier deutsche Unis in die Top 100, in „Clinical, Pre-clinical<br />
& Health“ schrumpelte es gar runter auf zwei.)<br />
Doch nicht nur die Forschungspolitiker haben den Begriff<br />
„exzellent“ derart erfolgreich abgenutzt, dass er einem heute<br />
vorkommt wie ein Champagner-Etikett auf einer Sprudelflasche.<br />
Auch die Forscher selbst beteuern zunehmend gebetsmühlenartig,<br />
dass sie Anträge einzig nach dem Kriterium der „Scientific<br />
Excellence“ begutachten. Und ist dann am Ende alles, was gefördert<br />
wird, tatsächlich „exzellent“?<br />
Wohl kaum. Was sicher auch daran<br />
liegt, dass „Exzellenz“ so wenig griffig ist.<br />
Denn wann ist etwas „exzellent“, und ab<br />
wann nicht mehr? Wenn etwas nur ein<br />
wenig besser daherkommt als der große<br />
Rest – ist es deswegen gleich „exzellent“?<br />
Man könnte meinen, der Konstanzer<br />
Philosoph und Wissenschaftstheoretiker<br />
Jürgen Mittelstraß habe es so gesehen,<br />
als er vor <strong>15</strong> Jahren in einem Essay zum<br />
Thema schrieb: „Ist Wissenschaft möglich ohne Durchschnittlichkeit<br />
oder Mittelmaß? Vermutlich nicht. [...] Damit Exzellenz<br />
wirklich werden kann, muss viel Qualität gegeben sein; und<br />
damit Qualität wirklich werden kann, muss viel Mittelmaß<br />
gegeben sein. Allein Exzellenz, nichts anderes, wollen wäre<br />
nicht nur wirklichkeitsfremd, sondern für die Entstehungsbedingungen<br />
von Exzellenz vermutlich fatal – sie verlöre die wissenschaftliche<br />
Artenvielfalt, aus der sie wächst. [...] Es ist das breite<br />
Mittelmaß, das auch in der Wissenschaft das Gewohnte ist, und<br />
es ist die breite Qualität, die aus dem Mittelmaß wächst, die uns<br />
in der Wissenschaft am Ende auch die Exzellenz beschert.“<br />
Mittelstraß sieht „Exzellenz“ folglich an der Spitze einer<br />
Pyramide – direkt über der „Qualität“, die wiederum auf einem<br />
breiten Fundament aus „Durchschnittlichkeit“ und „Mittelmaß“<br />
sitzt. Doch geht es ihm schlussendlich gar nicht um die Spitze,<br />
sondern vielmehr um das Fundament. Denn bricht dieses weg,<br />
hat man auch keine Spitze mehr. Mittelstraß plädiert daher<br />
dafür, auch das Mittelmaß sorgfältig und breit zu pflegen – denn<br />
nur daraus könne „Exzellenz“ entstehen, wie auch immer sie<br />
sich manifestiere. Ausschließlich reine „Exzellenz“ zu fordern,<br />
sei dagegen töricht.<br />
Lassen wir den Begriff also mal beiseite und fragen vielmehr:<br />
Wie bekomme ich denn möglichst gute Forschung, Spitzenforschung<br />
gar? Mit viel Geld, das ich in aufwändige Wettbewerbe<br />
pumpe? Unserem Chefredakteur kommt bei diesem Thema<br />
immer wieder ein kurzer Aufsatz des finnischen Evolutionsökologen<br />
Juha Mehilä in den Sinn. Einige Abschnitte daraus:<br />
„Ein Charakteristikum kreativer Forschungsumgebungen<br />
ist, dass sie in der Regel recht klein sind und damit enge und<br />
intensive Interaktionen zwischen den Individuen fördern.<br />
Desweiteren nennen Beschreibungen kreativer Forschungsumfelder<br />
immer wieder die Bedeutung der sogenannten ‚kollektiven<br />
Kreativität‘. Diese entsteht als emergente Eigenschaft aus<br />
den Wechselwirkungen von Personen mit unterschiedlichen<br />
Fähigkeiten, Ansichten und Ideen innerhalb eines informellen<br />
Forschungsnetzwerks. Solche informellen Forschungsnetzwerke<br />
stehen übrigens in scharfem Kontrast zu bürokratischen Organisationen,<br />
die vor allem Wiederholbarkeit und Vorhersagbarkeit<br />
schätzen – und daher Kreativität wegen ihrer Unberechenbarkeit<br />
eher hemmen. Hierarchiefreie, ungezwungene<br />
Wechselwirkungen scheinen<br />
folglich wesentliche Bestandteile für die<br />
Gestaltung kreativer Forschungsumgebungen<br />
zu sein.<br />
Ein interessantes Merkmal kreativer<br />
Forschungsumgebungen ist jedoch, dass<br />
man die Gründe für ihr Entstehen zumindest<br />
teilweise erkennt und versteht – dass<br />
es aber viel schwieriger ist, die Ursachen<br />
für entsprechende Misserfolge zu verstehen.<br />
Mit anderen Worten, es gibt ein ‚Unsichtbarkeitsproblem‘:<br />
Während wir von den positiven Beispielen lernen können, sind<br />
die negativen – wenn also alle notwendigen Bestandteile vorhanden<br />
waren, aber dennoch ‚nichts Besonderes‘ entstand – viel<br />
schwerer zu durchdringen. Der Erfolg hängt also offenbar nicht<br />
nur vom Zugang zu den notwendigen Ressourcen ab – ob materieller<br />
oder immaterieller Art –, sondern auch von der Abwesenheit<br />
gewisser Hindernisse. Wenn wir daher versuchen, kreative<br />
Forschungsumgebungen zu gestalten, scheint die Identifikation<br />
solcher Hindernisse ebenso wichtig zu sein wie die Ermittlung<br />
der begünstigenden Faktoren – wenn nicht sogar wichtiger.<br />
Denn wie wir alle wissen, sind empfindliche Geräte schwer zu<br />
bauen, aber sehr leicht kaputt zu machen.“<br />
War es nicht so, dass für die „Exzellenzinitiative“ enorme<br />
zusätzliche Verwaltungskapazitäten geschaffen werden mussten...?<br />
Die Redaktion<br />
Laborjournal <strong>11</strong>/20<strong>15</strong><br />
3