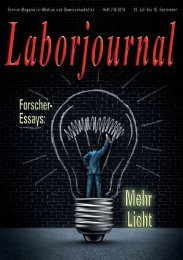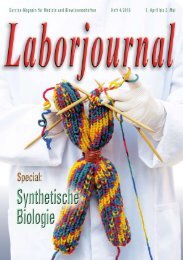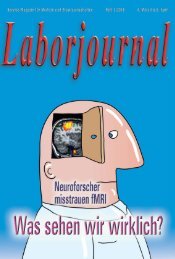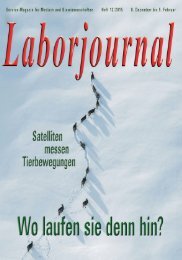LJ_15_11
LJ_15_11
LJ_15_11
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Journal Club<br />
Vogel-Partnerschaft in Seewiesen<br />
Fotos (2): Wolfgang Forstmeier<br />
Drum prüfe,<br />
wer sich<br />
ewig bindet<br />
Seewiesener Max-Planck-Forscher zeigen,<br />
dass sich arrangierte Ehen negativ auf die<br />
Erfolgschancen der Nachkommen auswirken.<br />
Auch wenn der Mann unter Anwendung bester<br />
Qualitätskriterien ausgesucht wurde, so kann<br />
man Liebe doch nicht erzwingen – jedenfalls<br />
bei Zebrafinken.<br />
Die in Australien weit verbreiteten Zebrafinken leben in großen<br />
Gruppen, aber sie sind keineswegs ein anonymer Schwarm.<br />
Männchen und Weibchen bilden Pärchen und bleiben lebenslang<br />
monogam, und beide Eltern beteiligen sich gleichermaßen<br />
an der Aufzucht des Nachwuchses.<br />
Die frisch promovierte Forscherin Malika Ihle, die zuvor<br />
an der französischen Université de Bourgogne in Dijon Verhaltensökologie<br />
studiert hatte, widmete dem Paarungsverhalten<br />
der Zebrafinken fünf Jahre im Rahmen eines Projekts<br />
am Max-Planck-Institut für Ornithologie im oberbayerischen<br />
Seewiesen. Erschienen ist die Arbeit der drei Wissenschaftler<br />
Malika Ihle, Bart Kempenaers und Wolfgang Forstmeier nun in<br />
PLoS Biology (Vol. 13: e1002248).<br />
Die Versuchstiere der Max-Planck-Forscher waren nicht etwa<br />
Vögel aus der Zoohandlung, sondern Zebrafinken, die frei von<br />
menschlicher Selektion und nicht mehr als zwölf Generationen<br />
von ihren wilden australischen Vorfahren entfernt waren.<br />
Laut Ihle zeigt ihre Studie zum ersten Mal, dass es für ein<br />
erfolgreiches Vogelfamilienleben nicht so sehr auf die genetische<br />
Fitness der Partner ankommt, sondern darauf, ob sie sich<br />
zusagen. Der Nachwuchs von Vogelpärchen, die einander frei<br />
finden durften, hatte in den Experimenten der Seewiesener<br />
„Vogel-Verkuppler“: Katrin Martin, Melanie Schneider,<br />
Malika Ihle, Wolfgang Forstmeier, Uli Knief<br />
und Johannes Schreiber (v.l.n.r.)<br />
Ornithologen eine 37 Prozent höhere Überlebenschance als die<br />
Küken eigens arrangierter Paare. Aber warum?<br />
Tatsächlich ist unter Verhaltensbiologen umstritten, nach<br />
welchen Kriterien Weibchen ihre männlichen Partner auswählen.<br />
Man unterscheidet Konzepte der genetischen und der<br />
Verhaltenskompatibilität. Frühere Studien haben laut Ihle et al.<br />
bei der Auswahl der zugewiesenen Partner aber nicht darauf<br />
geachtet, ob diese für die Aufgabe fit genug waren. Die Max-<br />
Planck-Forscher machten das nun anders. Die Vögel durften sich<br />
zunächst frei für einen Partner entscheiden. Dann griffen die<br />
Verhaltensforscher bei einem Teil der Pärchen rücksichtslos ein,<br />
trennten sie und mischten sie neu. Die Zebrafinken hatten also<br />
ihren ehemaligen Partner bereits als „gut genug” auserwählt.<br />
Die jeweilige Fitness der am Versuch teilnehmenden Tiere war<br />
damit objektiv gesichert, aus der Vogelperspektive. Und tatsächlich<br />
blieb die Qualität der Embryos in den befruchteten Eiern der<br />
selbst erwählten und der arrangierten Pärchen ungefähr gleich.<br />
Zwangsehen fehlt Harmonie<br />
Im Vergleich zu Nachkommen der selbst gewählten Partner<br />
überlebten allerdings deutlich weniger der geschlüpften Küken<br />
aus arrangierten Ehen. Deren Eltern zeigten weniger Interesse<br />
und kümmerten sich schlechter umeinander und um die Brutaufzucht.<br />
Während die selbsterwählten Pärchen miteinander<br />
turtelten und die Küken hingebungsvoll gemeinsam fütterten,<br />
war die Harmonie bei den Zwangsehen dahin.<br />
Die Väter gingen, wenig überraschend, eher fremd, statt Eier<br />
auszubrüten oder Futter heranzuschaffen. Viele Eier wurden<br />
verlassen, verschwanden aus den Nestern oder wurden unbefruchtet<br />
gelegt. Letzteres lag wiederum daran, dass die Weibchen<br />
in den arrangierten Ehen wenig Interesse am Geschlechtsverkehr<br />
mit dem zugewiesenen Männchen zeigten. Aber auch<br />
die Männchen hatten weniger Interesse, gegenüber einer vom<br />
Experimentator bestimmten Gattin einen Balztanz vorzuführen.<br />
Der Verlust des Partners ist für Zebrafinken relativ leicht<br />
zu bewältigen, denn in ihrer natürlichen Umgebung sind sie<br />
28<br />
<strong>11</strong>/20<strong>15</strong> Laborjournal