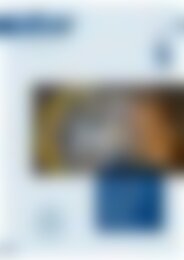Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>atw</strong> Vol. 63 (<strong>2018</strong>) | Issue 8/9 ı August/September<br />
440<br />
SPOTLIGHT ON NUCLEAR LAW<br />
Atomausstieg letzter Akt?<br />
Sind die neuen Entschädigungs regelungen für frustrierte<br />
Aufwendungen und nicht mehr verstrombare Elektrizitätsmengen<br />
im Atomgesetz verfassungsgemäß?<br />
Tobias Leidinger<br />
Kurz vor knapp hat der Gesetzgeber auf die verfassungsrechtlichen Mängel reagiert, die das Bundesverfassungsgericht<br />
(BVerfG) in seinem Urteil vom 6. Dezember 2016 zum Atomausstieg (BVerfGE 143, 246) höchstrichterlich<br />
beanstandet hat. Doch die neu geschaffenen Entschädigungsregelungen in der 16. AtG-Novelle werfen neue<br />
Rechtsfragen auf, insbesondere die nach ihrer Verfassungsgemäßheit.<br />
I. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts<br />
Nach dem BVerfG-Urteil vom 6. Dezember 2016 musste<br />
der Gesetzgeber bis zum 30. Juni <strong>2018</strong> in Bezug auf<br />
den Atomausstieg einen verfassungsmäßigen Zustand<br />
herstellen (vgl. dazu Leidinger, <strong>atw</strong> 2017, S. 26 ff.). Dies<br />
erfolgt jetzt durch Entschädigungsregelungen, die durch<br />
das Sechzehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes<br />
(16. AtGÄndG), in das Atomgesetz eingefügt werden (vgl.<br />
BT-Drs. 19/2508). Da das Änderungsgesetz im Hinblick<br />
auf seine beihilferechtlichen Auswirkungen noch der<br />
Überprüfung durch die EU-Kommission bedarf, kann das<br />
Gesetz, das vom Bundestag am 28. Juni <strong>2018</strong> beschlossen<br />
wurde, nicht sofort in Kraft treten.<br />
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Kompensation<br />
in zweifacher Hinsicht gefordert: Zum einen bedarf es<br />
eines angemessenen Ausgleichs für frustrierte Aufwendungen,<br />
die die Betreiber im Vertrauen auf den<br />
Bestand der Ende 2010 zusätzlich gewährten Elektrizitätsmengen<br />
getroffen hatten. Zum anderen ist eine Kompensationsregelung<br />
für die Strommengen erforderlich, die<br />
den Betreibern 2002 im Rahmen des „Energiekonsens“<br />
(Atomausstieg I) zugestanden worden waren, die aber<br />
nunmehr – infolge des endgültigen Atomausstiegs II bis<br />
Ende 2022 – nicht mehr konzernintern verstromt werden<br />
können. Letzteres betrifft allein die Betreiber Vattenfall<br />
und RWE. E.ON verfügt noch über freie Kapazitäten, auch<br />
wenn sämtliche eigenen Mengen verstromt sind. EnBW ist<br />
nach eigenen Angaben nicht betroffen.<br />
Neben dem Deutschen Bundestag hat sich auch der<br />
Bundesrat mit den Regelungen befasst (BR-Drs. 205/18).<br />
Auch eine Sachverständigenanhörung hat es dazu am<br />
13. Juni <strong>2018</strong> im Umweltausschuss des Bundestages<br />
gegeben. Die vom Bundesrat erhobene Forderung, im<br />
Rahmen der gesetzlichen Neuregelung sicherzustellen,<br />
dass Rest strommengen nicht auf norddeutsche Kernkraftwerke<br />
(z.B. Emsland, Brokdorf) im Netzausbaugebiet<br />
übertragen werden dürfen – weil dann die Einspeisung<br />
regenerativer Energien eingeschränkt werde –, hat die<br />
Bundesregierung – zu Recht – zurückgewiesen (BT- Drs.<br />
19/2705). Eine solche Einschränkung von Übertragungsmöglichkeiten<br />
müsste zu weiteren, nicht mehr<br />
erzeugbaren Elektrizitätsmengen führen. Das wirft<br />
erneut verfassungsrechtliche Fragen auf, insbesondere<br />
nach einem finanziellen Ausgleich. Im Ergebnis käme es<br />
zu einer noch größeren Belastung für den öffentlichen<br />
Haushalt.<br />
II. „Angemessenheit“ der Kompensation<br />
von zentraler Bedeutung<br />
Von entscheidender Bedeutung ist, ob durch die<br />
neuen Entschädigungsregelungen die verfassungsrechtlich<br />
ge botene Angemessenheit in Bezug auf frustrierte<br />
Auf wendungen und nicht mehr verstrombare Strommengen<br />
hergestellt wird. Denn die „Angemessenheit“<br />
des Ausgleichs ist vom Bundesverfassungsgericht als<br />
zentrales Kriterium einer verfassungskonformen Regelung<br />
bestimmt worden. Fehlt es daran, wären die vom BVerfG<br />
aufgestellten Maßgaben verletzt. Fraglich ist also, ob der<br />
Gesetzgeber das ihm insoweit zukommende Gestaltungsermessen<br />
verfassungskonform ausgeübt hat.<br />
Für den Ausgleich nicht verstrombarer Strommengen<br />
hatte das Gericht drei verschiedene Optionen eröffnet:<br />
Zunächst wäre eine zeitlich auskömmliche Laufzeitverlängerung<br />
bis zu dem Zeitpunkt denkbar, in dem die<br />
ausgleichspflichtigen Strommengen tatsächlich konzernintern<br />
verstromt sind. Das wäre – aus Sicht des Steuerzahlers<br />
– der mit Abstand kostengünstigste Weg. Er wurde<br />
indes nicht beschritten. Es bleibt vielmehr dabei, dass<br />
die Nutzung der Kernenergie „zum frühestmöglichen<br />
Zeitpunkt beendet werden soll“, d.h. es wird am Enddatum<br />
31. Dezember 2022 unverändert festgehalten. Dieses<br />
Datum beruht indes auf einer rein politischen Festlegung,<br />
die bereits in der 13. AtG-Novelle im Jahr 2011 („Atomausstiegsgesetz“)<br />
vorgenommen wurde. Sodann besteht die<br />
Option, eine Weitergabemöglichkeit von Reststrommengen<br />
zu ökonomisch zumutbaren Bedingungen gesetzlich<br />
sicherzustellen oder – als dritte Möglichkeit – einen<br />
angemessenen finanziellen Ausgleich für konzernintern<br />
nicht verstrombare Reststrommengen zu gewähren.<br />
III. Ausgleich für nicht mehr verstrombare<br />
Elektrizitätsmengen<br />
Das neue Gesetz bestimmt mit § 7f AtG (neu) einen<br />
lediglich „konditionierten“ Geldausgleich für nicht mehr<br />
verstrombare Elektrizitätsmengen. Danach müssen sich<br />
die Kraftwerksbetreiber mit nicht verstrombaren Elektrizitätsmengen<br />
zunächst, d.h. primär „ernsthaft darum<br />
bemühen“, diese Mengen an andere Kraftwerksbetreiber<br />
„zu angemessenen Bedingungen zu übertragen“, die zwar<br />
noch über Kernkraftwerke, aber nicht mehr über Elektrizitätskontingente<br />
zur Verstromung verfügen. Nur wenn und<br />
soweit Strommengen zu diesen Bedingungen nicht mehr<br />
übertragen werden konnten, greift dann – sozusagen<br />
subsidiär – eine finanzielle Kompensation.<br />
Es ist mehr als fraglich, ob das Gesetz mit dieser<br />
Regelung den höchstrichterlichen Vorgaben gerecht wird:<br />
Der vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Verstoß<br />
gegen Art. 14 Abs. 1 (Eigentum) und das Gleichheitsgebot<br />
aus Art. 3 Abs. 1 GG resultiert doch gerade daraus, dass es<br />
aufgrund des Ausstiegsgesetzes (13. AtG-Novelle) zu<br />
einem Nachfragemonopol hinsichtlich der nicht mehr<br />
verstrombaren Mengen kommt, also einer Situation, die<br />
per se keine „angemessenen Bedingungen“ für eine<br />
konzernübergreifende Veräußerung der Strommengen<br />
zulässt (vgl. BVerfGE 143, 246 (361)).<br />
Spotlight on Nuclear Law<br />
Nuclear Phase-out Last Act? Are the New Compensation Regulations for Frustrated Expenses in Accordance with the Constitution? ı Tobias Leidinger