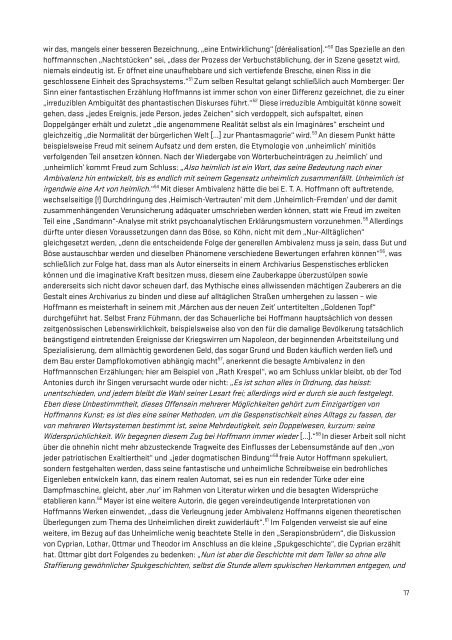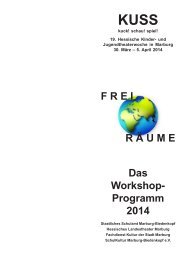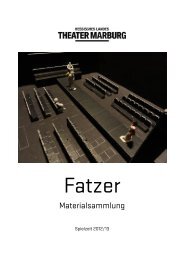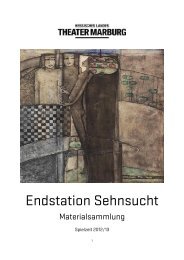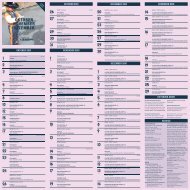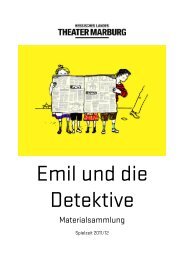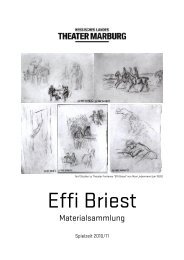Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wir das, mangels einer besseren Bezeichnung, „eine Entwirklichung“ (déréalisation).“ 50 Das Spezielle an den<br />
hoffmannschen „Nachtstücken“ sei, „dass der Prozess der Verbuchstäblichung, der in Szene gesetzt wird,<br />
niemals eindeutig ist. Er öffnet eine unaufhebbare und sich vertiefende Bresche, einen Riss in die<br />
geschlossene Einheit des Sprachsystems.“ 51 Zum selben Resultat gelangt schließlich auch Momberger: Der<br />
Sinn einer fantastischen Erzählung Hoffmanns ist immer schon von einer Differenz gezeichnet, die zu einer<br />
„irreduziblen Ambiguität des phantastischen Diskurses führt.“ 52 Diese irreduzible Ambiguität könne soweit<br />
gehen, dass „jedes Ereignis, jede Person, jedes Zeichen“ sich verdoppelt, sich aufspaltet, einen<br />
Doppelgänger erhält und zuletzt „die angenommene Realität selbst als ein Imaginäres“ erscheint und<br />
gleichzeitig „die Normalität der bürgerlichen Welt [...] zur Phantasmagorie“ wird. 53 An diesem Punkt hätte<br />
beispielsweise Freud mit seinem Aufsatz und dem ersten, die Etymologie von ‚unheimlich’ minitiös<br />
verfolgenden Teil ansetzen können. Nach der Wiedergabe von Wörterbucheinträgen zu ‚heimlich’ und<br />
‚unheimlich’ kommt Freud zum Schluss: „Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer<br />
Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist<br />
irgendwie eine Art von heimlich.“ 54 Mit dieser Ambivalenz hätte die bei E. T. A. Hoffmann oft auftretende,<br />
wechselseitige (!) Durchdringung des ‚Heimisch-Vertrauten’ mit dem ‚Unheimlich-Fremden’ und der damit<br />
zusammenhängenden Verunsicherung adäquater umschrieben werden können, statt wie Freud im zweiten<br />
Teil eine „Sandmann“-Analyse mit strikt psychoanalytischen Erklärungsmustern vorzunehmen. 55 Allerdings<br />
dürfte unter diesen Voraussetzungen dann das Böse, so Köhn, nicht mit dem „Nur-Alltäglichen“<br />
gleichgesetzt werden, „denn die entscheidende Folge der generellen Ambivalenz muss ja sein, dass Gut und<br />
Böse austauschbar werden und dieselben Phänomene verschiedene Bewertungen erfahren können“ 56 , was<br />
schließlich zur Folge hat, dass man als Autor einerseits in einem Archivarius Gespenstisches erblicken<br />
können und die imaginative Kraft besitzen muss, diesem eine Zauberkappe überzustülpen sowie<br />
andererseits sich nicht davor scheuen darf, das Mythische eines allwissenden mächtigen Zauberers an die<br />
Gestalt eines Archivarius zu binden und diese auf alltäglichen Straßen umhergehen zu lassen – wie<br />
Hoffmann es meisterhaft in seinem mit ‚Märchen aus der neuen Zeit’ untertitelten „Goldenen Topf“<br />
durchgeführt hat. Selbst Franz Fühmann, der das Schauerliche bei Hoffmann hauptsächlich von dessen<br />
zeitgenössischen Lebenswirklichkeit, beispielsweise also von den für die damalige Bevölkerung tatsächlich<br />
beängstigend eintretenden Ereignisse der Kriegswirren um Napoleon, der beginnenden Arbeitsteilung und<br />
Spezialisierung, dem allmächtig gewordenen Geld, das sogar Grund und Boden käuflich werden ließ und<br />
dem Bau erster Dampflokomotiven abhängig macht 57 , anerkennt die besagte Ambivalenz in den<br />
Hoffmannschen Erzählungen; hier am Beispiel von „Rath Krespel“, wo am Schluss unklar bleibt, ob der Tod<br />
Antonies durch ihr Singen verursacht wurde oder nicht: „Es ist schon alles in Ordnung, das heisst:<br />
unentschieden, und jedem bleibt die Wahl seiner Lesart frei; allerdings wird er durch sie auch festgelegt.<br />
Eben diese Unbestimmtheit, dieses Offensein mehrerer Möglichkeiten gehört zum Einzigartigen von<br />
Hoffmanns Kunst; es ist dies eine seiner Methoden, um die Gespenstischkeit eines Alltags zu fassen, der<br />
von mehreren Wertsystemen bestimmt ist, seine Mehrdeutigkeit, sein Doppelwesen, kurzum: seine<br />
Widersprüchlichkeit. Wir begegnen diesem Zug bei Hoffmann immer wieder [...].“ 58 In dieser Arbeit soll nicht<br />
über die ohnehin nicht mehr abzusteckende Tragweite des Einflusses der Lebensumstände auf den „von<br />
jeder patriotischen Exaltiertheit“ und „jeder dogmatischen Bindung“ 59 freie Autor Hoffmann spekuliert,<br />
sondern festgehalten werden, dass seine fantastische und unheimliche Schreibweise ein bedrohliches<br />
Eigenleben entwickeln kann, das einem realen Automat, sei es nun ein redender Türke oder eine<br />
Dampfmaschine, gleicht, aber ‚nur’ im Rahmen von Literatur wirken und die besagten Widersprüche<br />
etablieren kann. 60 Mayer ist eine weitere Autorin, die gegen vereindeutigende Interpretationen von<br />
Hoffmanns Werken einwendet, „dass die Verleugnung jeder Ambivalenz Hoffmanns eigenen theoretischen<br />
Überlegungen zum Thema des Unheimlichen direkt zuwiderläuft“. 61 Im Folgenden verweist sie auf eine<br />
weitere, im Bezug auf das Unheimliche wenig beachtete Stelle in den „Serapionsbrüdern“, die Diskussion<br />
von Cyprian, Lothar, Ottmar und Theodor im Anschluss an die kleine „Spukgeschichte“, die Cyprian erzählt<br />
hat. Ottmar gibt dort Folgendes zu bedenken: „Nun ist aber die Geschichte mit dem Teller so ohne alle<br />
Staffierung gewöhnlicher Spukgeschichten, selbst die Stunde allem spukischen Herkommen entgegen, und<br />
17