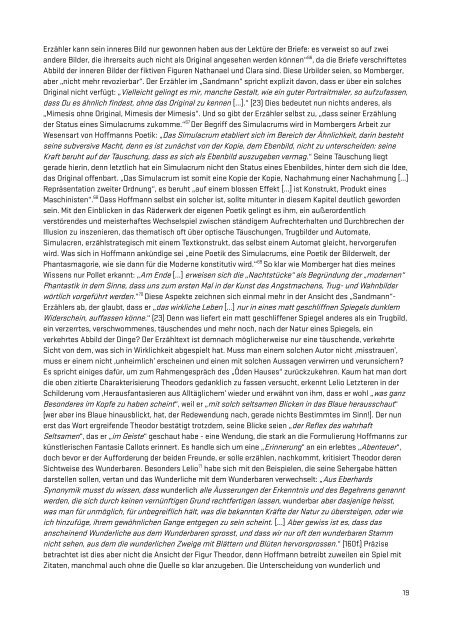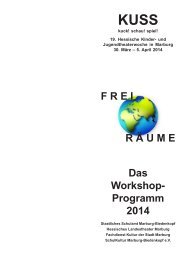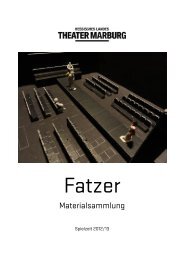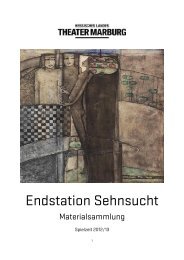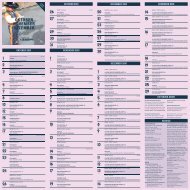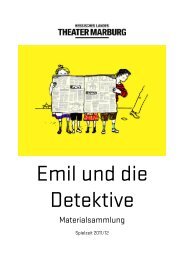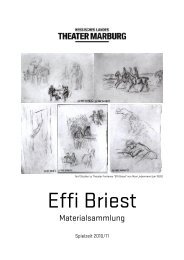Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erzähler kann sein inneres Bild nur gewonnen haben aus der Lektüre der Briefe: es verweist so auf zwei<br />
andere Bilder, die ihrerseits auch nicht als Original angesehen werden können“ 66 , da die Briefe verschriftetes<br />
Abbild der inneren Bilder der fiktiven Figuren Nathanael und Clara sind. Diese Urbilder seien, so Momberger,<br />
aber „nicht mehr revozierbar“. Der Erzähler im „Sandmann“ spricht explizit davon, dass er über ein solches<br />
Original nicht verfügt: „Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt, wie ein guter Portraitmaler, so aufzufassen,<br />
dass Du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen [...].“ (23) Dies bedeutet nun nichts anderes, als<br />
„Mimesis ohne Original, Mimesis der Mimesis“. Und so gibt der Erzähler selbst zu, „dass seiner Erzählung<br />
der Status eines Simulacrums zukomme.“ 67 Der Begriff des Simulacrums wird in Mombergers Arbeit zur<br />
Wesensart von Hoffmanns Poetik: „Das Simulacrum etabliert sich im Bereich der Ähnlichkeit, darin besteht<br />
seine subversive Macht, denn es ist zunächst von der Kopie, dem Ebenbild, nicht zu unterscheiden: seine<br />
Kraft beruht auf der Täuschung, dass es sich als Ebenbild auszugeben vermag.“ Seine Täuschung liegt<br />
gerade hierin, denn letztlich hat ein Simulacrum nicht den Status eines Ebenbildes, hinter dem sich die Idee,<br />
das Original offenbart. „Das Simulacrum ist somit eine Kopie der Kopie, Nachahmung einer Nachahmung [...]<br />
Repräsentation zweiter Ordnung“, es beruht „auf einem blossen Effekt [...] ist Konstrukt, Produkt eines<br />
Maschinisten“. 68 Dass Hoffmann selbst ein solcher ist, sollte mitunter in diesem Kapitel deutlich geworden<br />
sein. Mit den Einblicken in das Räderwerk der eigenen Poetik gelingt es ihm, ein außerordentlich<br />
verstörendes und meisterhaftes Wechselspiel zwischen ständigem Aufrechterhalten und Durchbrechen der<br />
Illusion zu inszenieren, das thematisch oft über optische Täuschungen, Trugbilder und Automate,<br />
Simulacren, erzählstrategisch mit einem Textkonstrukt, das selbst einem Automat gleicht, hervorgerufen<br />
wird. Was sich in Hoffmann ankündige sei „eine Poetik des Simulacrums, eine Poetik der Bilderwelt, der<br />
Phantasmagorie, wie sie dann für die Moderne konstitutiv wird.“ 69 So klar wie Momberger hat dies meines<br />
Wissens nur Pollet erkannt: „Am Ende [...] erweisen sich die „Nachtstücke“ als Begründung der „modernen“<br />
Phantastik in dem Sinne, dass uns zum ersten Mal in der Kunst des Angstmachens, Trug- und Wahnbilder<br />
wörtlich vorgeführt werden.“ 70 Diese Aspekte zeichnen sich einmal mehr in der Ansicht des „Sandmann“-<br />
Erzählers ab, der glaubt, dass er „das wirkliche Leben [...] nur in eines matt geschliffnen Spiegels dunklem<br />
Widerschein, auffassen könne.“ (23) Denn was liefert ein matt geschliffener Spiegel anderes als ein Trugbild,<br />
ein verzerrtes, verschwommenes, täuschendes und mehr noch, nach der Natur eines Spiegels, ein<br />
verkehrtes Abbild der Dinge? Der Erzähltext ist demnach möglicherweise nur eine täuschende, verkehrte<br />
Sicht von dem, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat. Muss man einem solchen Autor nicht ‚misstrauen’,<br />
muss er einem nicht ‚unheimlich’ erscheinen und einen mit solchen Aussagen verwirren und verunsichern?<br />
Es spricht einiges dafür, um zum Rahmengespräch des „Öden Hauses“ zurückzukehren. Kaum hat man dort<br />
die oben zitierte Charakterisierung Theodors gedanklich zu fassen versucht, erkennt Lelio Letzteren in der<br />
Schilderung vom ‚Herausfantasieren aus Alltäglichem’ wieder und erwähnt von ihm, dass er wohl „was ganz<br />
Besonderes im Kopfe zu haben scheint“, weil er „mit solch seltsamen Blicken in das Blaue herausschaut“<br />
(wer aber ins Blaue hinausblickt, hat, der Redewendung nach, gerade nichts Bestimmtes im Sinn!). Der nun<br />
erst das Wort ergreifende Theodor bestätigt trotzdem, seine Blicke seien „der Reflex des wahrhaft<br />
Seltsamen“, das er „im Geiste“ geschaut habe - eine Wendung, die stark an die Formulierung Hoffmanns zur<br />
künstlerischen Fantasie Callots erinnert. Es handle sich um eine „Erinnerung“ an ein erlebtes „Abenteuer“,<br />
doch bevor er der Aufforderung der beiden Freunde, er solle erzählen, nachkommt, kritisiert Theodor deren<br />
Sichtweise des Wunderbaren. Besonders Lelio 71 habe sich mit den Beispielen, die seine Sehergabe hätten<br />
darstellen sollen, vertan und das Wunderliche mit dem Wunderbaren verwechselt: „Aus Eberhards<br />
Synonymik musst du wissen, dass wunderlich alle Äusserungen der Erkenntnis und des Begehrens genannt<br />
werden, die sich durch keinen vernünftigen Grund rechtfertigen lassen, wunderbar aber dasjenige heisst,<br />
was man für unmöglich, für unbegreiflich hält, was die bekannten Kräfte der Natur zu übersteigen, oder wie<br />
ich hinzufüge, ihrem gewöhnlichen Gange entgegen zu sein scheint. [...] Aber gewiss ist es, dass das<br />
anscheinend Wunderliche aus dem Wunderbaren sprosst, und dass wir nur oft den wunderbaren Stamm<br />
nicht sehen, aus dem die wunderlichen Zweige mit Blättern und Blüten hervorsprossen.“ (160f.) Präzise<br />
betrachtet ist dies aber nicht die Ansicht der Figur Theodor, denn Hoffmann betreibt zuweilen ein Spiel mit<br />
Zitaten, manchmal auch ohne die Quelle so klar anzugeben. Die Unterscheidung von wunderlich und<br />
19