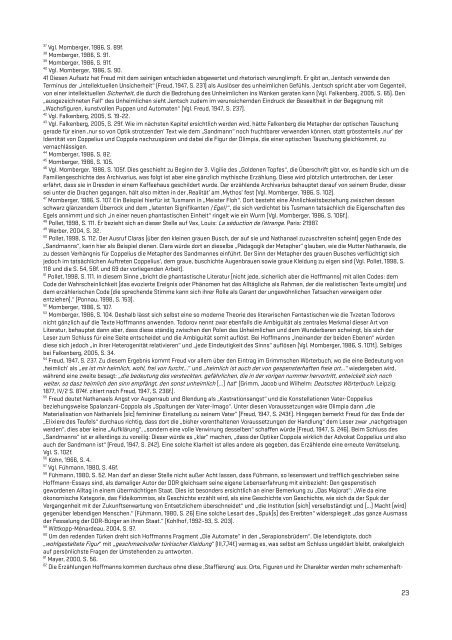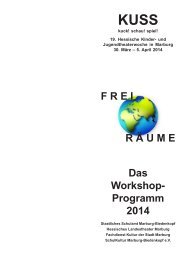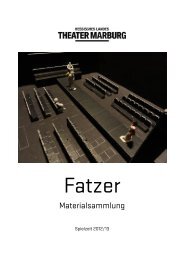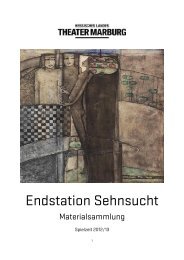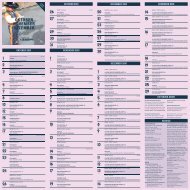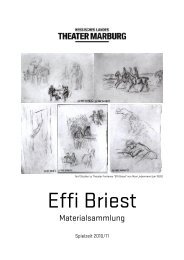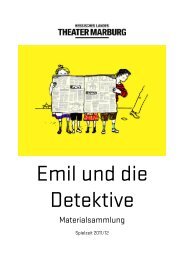Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Materialiensammlung - Theater Marburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
37 Vgl. Momberger, 1986, S. 89f.<br />
38 Momberger, 1986, S. 91.<br />
39 Momberger, 1986, S. 91f.<br />
40 Vgl. Momberger, 1986, S. 90.<br />
41 Diesen Aufsatz hat Freud mit dem seinigen entschieden abgewertet und rhetorisch verunglimpft. Er gibt an, Jentsch verwende den<br />
Terminus der „intellektuellen Unsicherheit“ (Freud, 1947, S. 231) als Auslöser des unheimlichen Gefühls. Jentsch spricht aber vom Gegenteil,<br />
von einer intellektuellen Sicherheit, die durch die Bedrohung des Unheimlichen ins Wanken geraten kann (Vgl. Falkenberg, 2005, S. 65). Den<br />
„ausgezeichneten Fall“ des Unheimlichen sieht Jentsch zudem im verunsichernden Eindruck der Beseeltheit in der Begegnung mit<br />
„Wachsfiguren, kunstvollen Puppen und Automaten“ (Vgl. Freud, 1947, S. 237).<br />
42 Vgl. Falkenberg, 2005, S. 19-22.<br />
43 Vgl. Falkenberg, 2005, S. 29f. Wie im nächsten Kapitel ersichtlich werden wird, hätte Falkenberg die Metapher der optischen Täuschung<br />
gerade für einen ‚nur so von Optik strotzenden’ Text wie dem „Sandmann“ noch fruchtbarer verwenden können, statt grösstenteils ‚nur’ der<br />
Identität von Coppelius und Coppola nachzuspüren und dabei die Figur der Olimpia, die einer optischen Täuschung gleichkommt, zu<br />
vernachlässigen.<br />
44 Momberger, 1986, S. 82.<br />
45 Momberger, 1986, S. 105.<br />
46 Vgl. Momberger, 1986, S. 105f. Dies geschieht zu Beginn der 3. Vigilie des „Goldenen Topfes“, die Überschrift gibt vor, es handle sich um die<br />
Familiengeschichte des Archivarius, was folgt ist aber eine gänzlich mythische Erzählung. Diese wird plötzlich unterbrochen, der Leser<br />
erfährt, dass sie in Dresden in einem Kaffeehaus geschildert wurde. Der erzählende Archivarius behauptet darauf von seinem Bruder, dieser<br />
sei unter die Drachen gegangen, hält also mitten in der ‚Realität’ am ‚Mythos’ fest (Vgl. Momberger, 1986, S. 102).<br />
47 Momberger, 1986, S. 107. Ein Beispiel hierfür ist Tusmann in „Meister Floh“. Dort besteht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dessen<br />
schwarz glänzendem Überrock und dem „latenten Signifikanten /Egel/“, die sich verdichtet bis Tusmann tatsächlich die Eigenschaften des<br />
Egels annimmt und sich „in einer neuen phantastischen Einheit“ ringelt wie ein Wurm (Vgl. Momberger, 1986, S. 106f.).<br />
48 Pollet, 1998, S. 111. Er bezieht sich an dieser Stelle auf Vax, Louis: La séduction de l’étrange. Paris: 21987.<br />
49 Werber, 2004, S. 32.<br />
50 Pollet, 1998, S. 112. Der Ausruf Claras (über den kleinen grauen Busch, der auf sie und Nathanael zuzuschreiten scheint) gegen Ende des<br />
„Sandmanns“, kann hier als Beispiel dienen. Clara würde dort an dieselbe „Pädagogik der Metapher“ glauben, wie die Mutter Nathanaels, die<br />
zu dessen Verhängnis für Coppelius die Metapher des Sandmannes einführt. Der Sinn der Metapher des grauen Busches verflüchtigt sich<br />
jedoch im tatsächlichen Auftreten Coppelius’, dem graue, buschichte Augenbrauen sowie graue Kleidung zu eigen sind (Vgl. Pollet, 1998, S.<br />
118 und die S. 54, 58f. und 69 der vorliegenden Arbeit).<br />
51 Pollet, 1998, S. 111. In diesem Sinne „bricht die phantastische Literatur [nicht jede, sicherlich aber die Hoffmanns] mit allen Codes: dem<br />
Code der Wahrscheinlichkeit (das evozierte Ereignis oder Phänomen hat das Alltägliche als Rahmen, der die realistischen Texte umgibt) und<br />
dem erzählerischen Code (die sprechende Stimme kann sich ihrer Rolle als Garant der ungewöhnlichen Tatsachen verweigern oder<br />
entziehen).“ (Ponnau, 1998, S. 153).<br />
52 Momberger, 1986, S. 107.<br />
53 Momberger, 1986, S. 104. Deshalb lässt sich selbst eine so moderne Theorie des literarischen Fantastischen wie die Tvzetan Todorovs<br />
nicht gänzlich auf die Texte Hoffmanns anwenden. Todorov nennt zwar ebenfalls die Ambiguität als zentrales Merkmal dieser Art von<br />
Literatur, behauptet dann aber, dass diese ständig zwischen den Polen des Unheimlichen und dem Wunderbaren schwingt, bis sich der<br />
Leser zum Schluss für eine Seite entscheidet und die Ambiguität somit auflöst. Bei Hoffmanns „Ineinander der beiden Ebenen“ würden<br />
diese sich jedoch „in ihrer Heterogenität relativieren“ und „jede Eindeutigkeit des Sinns“ auflösen (Vgl. Momberger, 1986, S. 101f.). Selbiges<br />
bei Falkenberg, 2005, S. 34.<br />
54 Freud, 1947, S. 237. Zu diesem Ergebnis kommt Freud vor allem über den Eintrag im Grimmschen Wörterbuch, wo die eine Bedeutung von<br />
‚heimlich’ als „es ist mir heimlich, wohl, frei von furcht...“ und „heimlich ist auch der von gespensterhaften freie ort...“ wiedergeben wird,<br />
während eine zweite besagt: „die bedeutung des versteckten. gefährlichen, die in der vorigen nummer hervortritt, entwickelt sich noch<br />
weiter, so dasz heimlich den sinn empfängt, den sonst unheimlich [...] hat“ (Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig:<br />
1877, IV/2 S. 874f. zitiert nach Freud, 1947, S. 236f.).<br />
55 Freud deutet Nathanaels Angst vor Augenraub und Blendung als „Kastrationsangst“ und die Konstellationen Vater-Coppelius<br />
beziehungsweise Spalanzani-Coppola als „Spaltungen der Vater-Imago“. Unter diesen Voraussetzungen wäre Olimpia dann „die<br />
Materialisation von Nathaniels [sic] femininer Einstellung zu seinem Vater“ (Freud, 1947, S. 243f.). Hingegen bemerkt Freud für das Ende der<br />
„Elixiere des Teufels“ durchaus richtig, dass dort die „bisher vorenthaltenen Voraussetzungen der Handlung“ dem Leser zwar „nachgetragen<br />
werden“, dies aber keine „Aufklärung“, „sondern eine volle Verwirrung desselben“ schaffen würde (Freud, 1947, S. 246). Beim Schluss des<br />
„Sandmanns“ ist er allerdings zu voreilig: Dieser würde es „klar“ machen, „dass der Optiker Coppola wirklich der Advokat Coppelius und also<br />
auch der Sandmann ist“ (Freud, 1947, S. 242). Eine solche Klarheit ist alles andere als gegeben, das Erzählende eine erneute Verrätselung.<br />
Vgl. S. 102f.<br />
56 Köhn, 1966, S. 4.<br />
57 Vgl. Fühmann, 1980, S. 46f.<br />
58 Fühmann, 1980, S. 52. Man darf an dieser Stelle nicht außer Acht lassen, dass Fühmann, so lesenswert und trefflich geschrieben seine<br />
Hoffmann-Essays sind, als damaliger Autor der DDR gleichsam seine eigene Lebenserfahrung mit einbezieht: Den gespenstisch<br />
gewordenen Alltag in einem übermächtigen Staat. Dies ist besonders ersichtlich an einer Bemerkung zu „Das Majorat“: „Wie da eine<br />
ökonomische Kategorie, das Fideikommiss, als Geschichte erzählt wird, als eine Geschichte von Geschichte, wie sich da der Spuk der<br />
Vergangenheit mit der Zukunftserwartung von Entsetzlichem überschneidet“ und „die Institution [sich] verselbständigt und [...] Macht [wird]<br />
gegenüber lebendigen Menschen.“ (Fühmann, 1980, S. 26) Eine solche Lesart des „Spuk[s] des Ererbten“ widerspiegelt „das ganze Ausmass<br />
der Fesselung der DDR-Bürger an ihren Staat.“ (Kohlhof, 1992–93, S. 203).<br />
59 Wittkopp-Ménardeau, 2004, S. 97.<br />
60 Um den redenden Türken dreht sich Hoffmanns Fragment „Die Automate“ in den „Serapionsbrüdern“. Die lebendigtote, doch<br />
„wohlgestaltete Figur“ mit „geschmackvoller türkischer Kleidung“ (III,7,74f.) vermag es, was selbst am Schluss ungeklärt bleibt, orakelgleich<br />
auf persönlichste Fragen der Umstehenden zu antworten.<br />
61 Mayer, 2000, S. 56.<br />
62 Die Erzählungen Hoffmanns kommen durchaus ohne diese ‚Staffierung’ aus. Orte, Figuren und ihr Charakter werden mehr schemenhaft-<br />
23