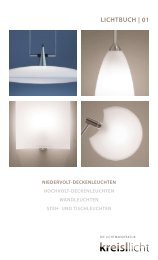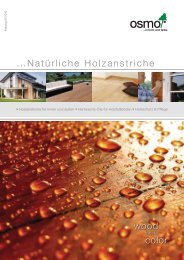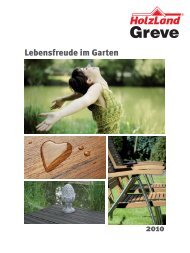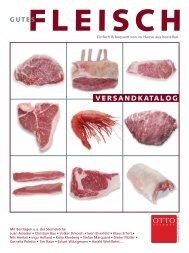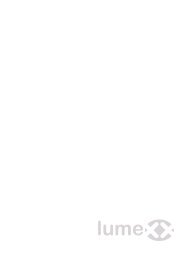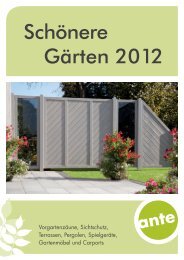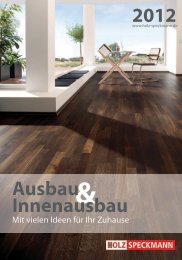Outdoor - An Aus Licht
Outdoor - An Aus Licht
Outdoor - An Aus Licht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Licht</strong>technik<br />
Kriterien guter Außenbeleuchtung<br />
Gleichmäßigkeit<br />
Wichtig für das Wahrnehmen von Fahrzeugen,<br />
Personen, Gegenständen und Details ist<br />
die örtliche Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte<br />
bzw. Beleuchtungsstärke. Während sich das<br />
Auge in einem großen Umfang an veränderte<br />
mittlere Leuchtdichten anpassen (adaptieren)<br />
kann, entstehen aus der Sicht z. B. des<br />
Kraftfahrers als Folge ungenügender Leuchtdichtegleichmäßigkeit<br />
Tarnzonen, die jedoch<br />
nicht als solche wahrgenommen werden.<br />
Diese bilden Gefahrenquellen für Kraftfahrer<br />
und Fußgänger. Tarnzonen entstehen durch<br />
Abschalten einzelner <strong>Licht</strong>punkte z. B. im<br />
Zuge einer Straßenbeleuchtung, etwa um<br />
Kosten einzusparen. Durch solche Abschaltungen<br />
wird das Verkehrsrisiko deswegen<br />
erhöht, weil der Kraftfahrer im sicheren Vertrauen<br />
auf seine Sehleistung auf beleuchteten<br />
Straßen in diese Tarnzonen fährt und die<br />
Hindernisse nicht rechtzeitig erkennt. Tarnzonen<br />
und damit Gefahrenquellen entstehen<br />
auch durch ungenügend beleuchtete Bereiche<br />
in Arbeitsstätten.<br />
Der Bereich der Sehaufgabe muss so gleichmäßig<br />
wie möglich beleuchtet werden. Die<br />
Gesamtgleichmäßigkeit im Bereich der Sehaufgabe<br />
oder der Verkehrsfläche U 0 = L min/L -<br />
gilt für die gesamte Bewertungsfläche.<br />
Eine unzureichende Gesamtgleichmäßigkeit<br />
kennzeichnet Tarnzonen. Dadurch wird das<br />
rechtzeitige Erkennen z. B. von Fußgängern,<br />
die spontan auf die Fahrbahn treten, erschwert<br />
oder gar unmöglich gemacht. Für<br />
Verkehrswege ist zusätzlich die Längsgleichmäßigkeit<br />
U l definiert. Sie bezieht sich auf<br />
die Mitte des Fahrstreifens, auf die sich die<br />
Aufmerksamkeit des Verkehrsteilnehmers<br />
im Wesentlichen konzentriert. Sie wird durch<br />
das Verhältnis der minimalen Leuchtdichte<br />
L l, min zur maximalen Leuchtdichte L l, max auf<br />
dieser Linie beschrieben: U l = L l, min/L l, max.<br />
Mindestwerte für die Gleichmäßigkeit der<br />
Beleuchtungsstärke U 0 sind in den betreffenden<br />
Normen enthalten. In Arbeitsstätten darf<br />
U 0 im Umgebungsbereich nicht geringer als<br />
0,10 sein.<br />
328<br />
Blendungsbewertung<br />
Arbeits- und Verkehrssicherheit können<br />
durch Blendung erheblich beeinträchtigt<br />
werden. Je nach Grad der Blendung können<br />
Unbehagen, Unsicherheit und Ermüdung<br />
(psychologische Blendung), aber auch merkbare<br />
Herabsetzung der Sehleistung (physiologische<br />
Blendung) auftreten. Um Fehler,<br />
Ermüdung und Unfälle zu vermeiden, ist es<br />
wichtig, Blendung zu begrenzen. Blendung<br />
wird durch helle Flächen im Gesichtsfeld<br />
hervorgerufen und kann entweder als psychologische<br />
Blendung oder als physiologische<br />
Blendung wahrgenommen werden. Die<br />
durch Reflexe auf spiegelnden Oberflächen<br />
verursachte Blendung ist allgemein bekannt<br />
als Schleierreflexion oder Reflexblendung.<br />
Der Grad der physiologisch wirkenden, also<br />
die Sehleistung beeinträchtigende Direktblendung<br />
durch Leuchten oder andere Blendlichtquellen,<br />
wird z. B. für Arbeits- und Sportstätten<br />
im Freien durch den Blendungswert<br />
GR (Glare Rating) beschrieben. Der GR-<br />
Blendwert basiert auf der äquivalenten<br />
Schleierleuchtdichte und ist in der Publikation<br />
CIE 112:1994 „Blendungsbewertungssystem<br />
für Außenbeleuchtungsanlagen und<br />
Beleuchtungsanlagen für Sport im Freien“<br />
beschrieben. Der Blendwert wird nach<br />
f olgender Formel bestimmt:<br />
GR = 27+24log 10<br />
Lvl ( Lve )<br />
0,9<br />
Dabei bedeuten:<br />
L vl die gesamte Schleierleuchtdichte in cd/m²,<br />
welche von der Beleuchtungsanlage verursacht<br />
wird. Sie ist die Summe der Schleierleuchtdichten<br />
der einzelnen Leuchten, d. h.<br />
der Blendlichtquellen L vl = L v1 + L v2 + ··· L vn.<br />
Die Schleierleuchtdichte der einzelnen<br />
Leuchte wird berechnet als L v = 10(E eye · θ -2 ).<br />
Dabei ist E eye die Beleuchtungsstärke am<br />
Auge des Beobachters auf einer Ebene senkrecht<br />
zur Blickrichtung (2° unter horizontal)<br />
und θ der Winkel zwischen der Blickrichtung<br />
des Beobachters und der (<strong>Licht</strong>-)<strong>Aus</strong>strahlrichtung<br />
jeder einzelnen Leuchte (Bild 1.5),<br />
L ve die äquivalente Schleierleuchtdichte der<br />
Umgebung in cd/m². <strong>Aus</strong>gehend von der<br />
<strong>An</strong>nahme, dass das Reflexionsverhalten der<br />
Umgebung vollkommen diffus ist, kann die<br />
äquivalente Schleierleuchtdichte berechnet<br />
werden als L ve = 0,035 · ◊ · E h,av · π -1 . Dabei<br />
ist ◊ der mittlere Reflexionsgrad und E h,av<br />
die mittlere Beleuchtungsstärke des Umgebungsbereichs.<br />
90°<br />
1.5 Winkel θ zwischen der Blickrichtung<br />
des Beobachters, die 2° unter der Horizontalen<br />
verläuft, und der <strong>Licht</strong>ausstrahlungsrichtung<br />
der Blendlichtquelle.<br />
Blendurteil GR-Wert<br />
unerträglich 80 – 90<br />
störend 60 – 70<br />
noch zulässig 40 – 50<br />
merklich 20 – 30<br />
unmerklich 10<br />
1.6 Blendurteile und GR-Wert.<br />
�<br />
2°