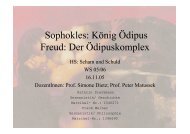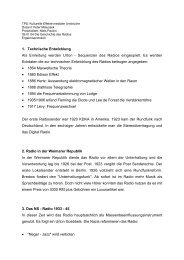Phänomelogie der Schrift - Peter-matussek.de
Phänomelogie der Schrift - Peter-matussek.de
Phänomelogie der Schrift - Peter-matussek.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Um das Hei<strong>de</strong>gger-Zitat zu verstehen, muss man wissen, dass unser Wort "lesen" vom griechischen "legein"<br />
bzw. lateinischen "legere" abgeleitet ist und ursprünglich "sammeln" im Sinne von "einsammeln" be<strong>de</strong>utet – was<br />
auch in unseren Worten "Traubenlese", "Blütenlese" etc. noch enthalten ist. Zugleich verbin<strong>de</strong>t sich mit <strong>de</strong>m<br />
Begriff <strong>de</strong>s Sammelns schon früh die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Sich-Sammelns, <strong><strong>de</strong>r</strong> Kontemplation – etwa im<br />
Knochenorakel, bei <strong>de</strong>m <strong><strong>de</strong>r</strong> Prozess <strong>de</strong>s Einsammelns <strong><strong>de</strong>r</strong> Knochen zugleich eine Konzentration auf das eigene<br />
Schicksal bewirkte. Auf diesen doppelten Sprachgebrauch spielt Hei<strong>de</strong>gger hier an.<br />
4. Lektürezentrierte Texttheorien<br />
Wie wir gesehen haben, wird das, was wir als <strong>Schrift</strong> wahrnehmen, durch <strong>de</strong>n Leser mit konstituiert. So spricht Umberto Eco beispielsweise von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
“Mitarbeit <strong>de</strong>s Lesers am Text”. Dies gilt auch für die höheren Ebenen <strong>de</strong>s Textverstehens. Nicht alle Texttheorien berücksichtigen das. Die in <strong>de</strong>n<br />
fünfziger und Anfang <strong><strong>de</strong>r</strong> sechziger Jahre <strong>de</strong>s vorigen Jahrhun<strong><strong>de</strong>r</strong>ts dominieren<strong>de</strong> “autorintentionale” o<strong><strong>de</strong>r</strong> “einfühlen<strong>de</strong>” Interpretation z. B. sah ihr Ziel<br />
darin, die sinnstiften<strong>de</strong> Absicht <strong>de</strong>s Autors zu rekonstruieren, und übersah dabei, dass auch <strong><strong>de</strong>r</strong> Autor eines Textes nur einer von verschie<strong>de</strong>nen Deutern<br />
seines Textes sein kann. Seit <strong><strong>de</strong>r</strong> Mitte <strong><strong>de</strong>r</strong> sechziger Jahre folgte ein radikaler Umschwung: Provokativ erklärte Roland Barthes 1968 <strong>de</strong>n “Tod <strong>de</strong>s<br />
Autors” und proklamierte die leserorientierte “Lust am Text” (Barthes 1968, Barthes 1973). Sozialgeschichtliche und rezeptionsästhetische (vgl.<br />
Hohendahl 1974) sowie strukturalistische und semiotische Texttheorien (vgl. Zima 1977) entwarfen Mo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>s Verstehens, die die Produktivität <strong>de</strong>s<br />
Lesers berücksichtigen.<br />
Im folgen<strong>de</strong>n seien drei prominente Texttheorien vorgestellt, die beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s geeignet sind, die Appellstrukturen zu ver<strong>de</strong>utlichen, mit <strong>de</strong>nen Texte die Mitarbeit <strong>de</strong>s<br />
Lesers an <strong><strong>de</strong>r</strong> Sinnstiftung herausfor<strong><strong>de</strong>r</strong>n.<br />
4.1 Roman Ingar<strong>de</strong>ns "Unbestimmtheitsstellen"<br />
Den Begriff <strong><strong>de</strong>r</strong> "Unbestimmtheitsstellen" prägte Ingar<strong>de</strong>n in seinem Hauptwerk von 1931: Das literarische<br />
Kunstwerk. Er erläutert dazu:<br />
"Das literarische Werk und insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e das literarische Kunstwerk, ist ein schematisches<br />
Gebil<strong>de</strong>. […] Min<strong>de</strong>stens eine seiner Schichten, und beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s die gegenständliche Schicht,<br />
enthalten in sich eine Reihe von 'Unbestimmtheitsstellen'. Eine solche Stelle zeigt sich<br />
überall dort, wo man aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> im Werk auftreten<strong>de</strong>n Sätze von einem<br />
bestimmten Gegenstand (o<strong><strong>de</strong>r</strong> von einer gegenständlichen Situation) nicht sagen kann,<br />
ob er eine bestimmte Eigenschaft besitzt o<strong><strong>de</strong>r</strong> nicht. Wenn etwa in <strong>de</strong>n 'Bud<strong>de</strong>nbrooks'<br />
die Augenfarbe <strong>de</strong>s Konsuls Bud<strong>de</strong>nbrook nicht erwähnt wäre (was ich nicht nachgeprüft<br />
habe), dann wäre er in dieser Hinsicht überhaupt nicht bestimmt, obwohl zugleich aufgrund<br />
<strong>de</strong>s Kontextes und <strong><strong>de</strong>r</strong> Tatsache, dass er irgen<strong>de</strong>ine Augenfarbe haben musste; nur welche,<br />
das wäre nicht entschie<strong>de</strong>n. Analog in vielen an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Fällen. Die Seite o<strong><strong>de</strong>r</strong> Stelle <strong>de</strong>s<br />
dargestellten Gegenstan<strong>de</strong>s, von <strong><strong>de</strong>r</strong> man auf Grund <strong>de</strong>s Textes nicht genau wissen kann,<br />
wie <strong><strong>de</strong>r</strong> betreffen<strong>de</strong> Gegenstand bestimmt ist, nenne ich eine 'Unbestimmtheitsstelle'. […]<br />
Roman Ingar<strong>de</strong>n (1893–1970)<br />
Dieses ergänzen<strong>de</strong> Bestimmen nenne ich das 'Konkretisieren' <strong><strong>de</strong>r</strong> dargestellten Gegenstän<strong>de</strong>. Darin kommt die eigene,<br />
mitschöpferische Tätigkeit <strong>de</strong>s Lesers zu Wort: aus eigener Initiative und Einbildungskraft 'füllt' er verschie<strong>de</strong>ne<br />
Unbestimmtheitsstellen mit Momenten 'aus', die sozusagen aus vielen möglichen bzw. zulässigen gewählt wer<strong>de</strong>n, obwohl<br />
letzteres […] nicht notwendig ist. Gewöhnlich vollzieht sich diese 'Wahl' ohne bewusste und für sich gefasste Absicht <strong>de</strong>s<br />
Lesers. Er lässt einfach seine Phantasie frei walten und ergänzt die betreffen<strong>de</strong>n Gegenstän<strong>de</strong> durch eine Reihe neuer<br />
Momente, so dass sie voll bestimmt zu sein scheinen." (Ingar<strong>de</strong>n 1968, S. 49 u. 52)<br />
Die Art <strong><strong>de</strong>r</strong> Konkretisationen fin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>n Texten keine Berechtigung (3.1.1) – ein Angelpunkt für die Rezeptionsästhetik <strong><strong>de</strong>r</strong> 60er Jahre<br />
(3.1.2).<br />
4.2 Wolfgang Isers "Leerstellen"<br />
Wolfgang Iser (*1926)<br />
Wolfgang Iser modifiziert Ingar<strong>de</strong>ns Konzept, in<strong>de</strong>m er zwischen<br />
"Unbestimmtheitsstellen" und "Leerstellen" unterschei<strong>de</strong>t. Ingar<strong>de</strong>n<br />
benutzte <strong>de</strong>n Begriff <strong><strong>de</strong>r</strong> Leerstelle synonym mit <strong>de</strong>m <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Unbestimmtheitsstelle (1931, S. 265); Iser betont dagegen:<br />
"Ergeben sich Leerstellen aus <strong>de</strong>n Unbestimmtheitsbeträgen <strong>de</strong>s<br />
Textes, so sollte man sie wohl Unbestimmtheitsstellen nennen, wie es<br />
Ingar<strong>de</strong>n getan hatte. Leerstellen in<strong>de</strong>s bezeichnen weniger eine<br />
Bestimmungslücke <strong>de</strong>s intentionalen Gegenstan<strong>de</strong>s bzw. <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
schematisierten Ansichten als vielmehr die Besetzbarkeit einer<br />
bestimmten Systemstelle im Text durch die Vorstellung <strong>de</strong>s<br />
Lesers. Statt einer Komplettierungsnotwendigkeit zeigen sie eine<br />
Kombinationsnotwendigkeit an." (Iser 1976, S. 284)<br />
Den systematischen Ort von Leerstellen bestimmt Iser durch das Aneinan<strong><strong>de</strong>r</strong>stoßen verschie<strong>de</strong>ner Textschichten,<br />
sogenannter "Schnitte" (4.2.1).<br />
Die Funktion <strong><strong>de</strong>r</strong> Leerstellen ist es nach Iser, <strong>de</strong>m Leser einen Auslegungsspielraum zu eröffnen, durch <strong>de</strong>n er <strong>de</strong>n Sinn<br />
mitkonstituiert (4.2.2).<br />
In neuerer Zeit hat Isers Begriff <strong><strong>de</strong>r</strong> Leerstelle weit über die Texthermeneutik hinaus Karriere gemacht – so in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Kunstgeschichte (4.2.3), <strong><strong>de</strong>r</strong> Filmtheorie (4.2.4) und <strong><strong>de</strong>r</strong> Musikwissenschaft (4.2.5).<br />
4.2.1 Der systematische Ort von Leerstellen<br />
http://peter-<strong>matussek</strong>.<strong>de</strong>/Leh/V_13_Materia!compact.php<br />
"Die Leerstellen eines literarischen Textes sind nun keineswegs, wie man vielleicht vermuten könnte, ein<br />
Manko, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n bil<strong>de</strong>n einen elementaren Ansatzpunkt für seine Wirkung. Der Leser wird sie in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Regel bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Lektüre <strong>de</strong>s Romans nicht eigens bemerken. Dennoch sind sie auf seine Lektüre nicht ganz<br />
ohne Einfluss [...]. Der Leser wird die Leerstellen dauernd auffüllen beziehungsweise beseitigen. In<strong>de</strong>m er<br />
sie beseitigt, nutzt er <strong>de</strong>n Auslegungsspielraum und stellt selbst die nicht formulierten Beziehungen<br />
zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Ansichten her. Dass dies so ist, lässt sich an <strong><strong>de</strong>r</strong> einfachen Erfahrungstatsache<br />
31.01.2009 19:40 Uhr