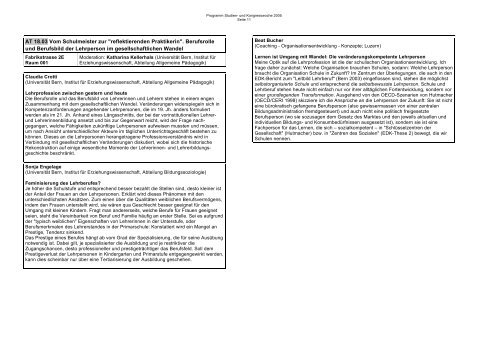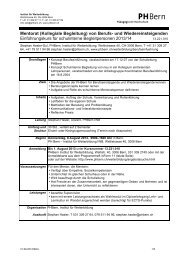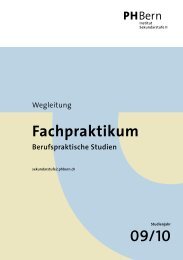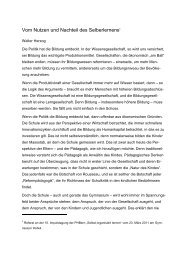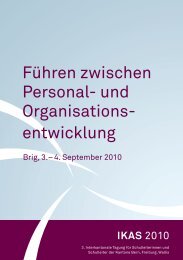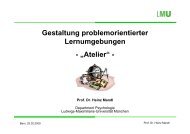Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AT 18.03 Vom Schulmeister zur "reflektierenden Praktikerin". Berufsrolle<br />
und Berufsbild der Lehrperson <strong>im</strong> gesellschaftlichen Wandel<br />
Fabrikstrasse 2E<br />
Raum 001<br />
Moderation: Katharina Kellerhals (Universität Bern, Institut für<br />
Erziehungswissenschaft, Abteilung Allgemeine Pädagogik)<br />
Claudia Crotti<br />
(Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Allgemeine Pädagogik)<br />
Lehrprofession zwischen gestern und heute<br />
Die Berufsrolle und das Berufsbild von Lehrerinnen und Lehrern stehen in einem engen<br />
Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel. Veränderungen widerspiegeln sich in<br />
Kompetenzanforderungen angehender Lehrpersonen, die <strong>im</strong> 19. Jh. anders formuliert<br />
werden als <strong>im</strong> 21. Jh. Anhand eines Längsschnitts, der bei der vorinstitutionellen Lehrer-<br />
und Lehrerinnenbildung ansetzt und bis zur Gegenwart reicht, wird der Frage nachgegangen,<br />
welche Fähigkeiten zukünftige Lehrpersonen aufweisen mussten und müssen,<br />
um nach Ansicht unterschiedlicher Akteure <strong>im</strong> täglichen Unterrichtsgeschäft bestehen zu<br />
können. Dieses an die Lehrpersonen herangetragene Professionsverständnis wird in<br />
Verbindung mit gesellschaftlichen Veränderungen diskutiert, wobei sich die historische<br />
Rekonstruktion auf einige wesentliche Momente der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgeschichte<br />
beschränkt.<br />
Sonja Engelage<br />
(Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Bildungssoziologie)<br />
Feminisierung des <strong>Lehrberuf</strong>es?<br />
Je höher die Schulstufe und entsprechend besser bezahlt die Stellen sind, desto kleiner ist<br />
der Anteil der Frauen an den Lehrpersonen. Erklärt wird dieses Phänomen mit den<br />
unterschiedlichsten Ansätzen. Zum einen über die Qualitäten weiblichen Berufsvermögens,<br />
indem den Frauen unterstellt wird, sie wären qua Geschlecht besser geeignet für den<br />
Umgang mit kleinen Kindern. Fragt man andererseits, welche Berufe für Frauen geeignet<br />
seien, steht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie häufig an erster Stelle. Sei es aufgrund<br />
der "typisch weiblichen" Eigenschaften von Lehrerinnen in der Unterstufe, oder<br />
Berufsmerkmalen des Lehrerstandes in der Pr<strong>im</strong>arschule: Konstatiert wird ein Mangel an<br />
Prestige, Tendenz sinkend.<br />
Das Prestige eines Berufes hängt ab vom Grad der Spezialisierung, die für seine Ausübung<br />
notwendig ist. Dabei gilt, je spezialisierter die Ausbildung und je restriktiver die<br />
Zugangschancen, desto professioneller und prestigeträchtiger das Berufsfeld. Soll dem<br />
Prestigeverlust der Lehrpersonen in Kindergarten und Pr<strong>im</strong>arstufe entgegengewirkt werden,<br />
kann dies scheinbar nur über eine Tertiarisierung der Ausbildung geschehen.<br />
Programm Studien- und Kongresswoche 2005<br />
Seite 11<br />
Beat Bucher<br />
(Coaching - Organisationsentwicklung - Konzepte; Luzern)<br />
Lernen ist Umgang mit Wandel: Die veränderungskompetente Lehrperson<br />
Meine Optik auf die Lehrprofession ist die der schulischen Organisationsentwicklung. Ich<br />
frage daher zunächst: Welche Organisation brauchen Schulen, sodann: Welche Lehrperson<br />
braucht die Organisation Schule in Zukunft? Im Zentrum der Überlegungen, die auch in den<br />
EDK-Bericht zum "Leitbild <strong>Lehrberuf</strong>" (Bern 2003) eingeflossen sind, stehen die möglichst<br />
selbstorganisierte Schule und entsprechend die selbstbewusste Lehrperson. Schule und<br />
<strong>Lehrberuf</strong> stehen heute nicht einfach nur vor ihrer alltäglichen Fortentwicklung, sondern vor<br />
einer grundlegenden Transformation. Ausgehend von den OECD-Szenarien von Hutmacher<br />
(OECD/CERI 1998) skizziere ich die Ansprüche an die Lehrperson der Zukunft: Sie ist nicht<br />
eine bürokratisch gefangene Berufsperson (also gewissermassen von einer zentralen<br />
Bildungsadministration fremdgesteuert) und auch nicht eine politisch freigesetzte<br />
Berufsperson (wo sie sozusagen dem Gesetz des Marktes und den jeweils aktuellen und<br />
individuellen Bildungs- und Konsumbedürfnissen ausgesetzt ist), sondern sie ist eine<br />
Fachperson für das Lernen, die sich – sozialkompetent – in "Schlüsselzentren der<br />
Gesellschaft" (Hutmacher) bzw. in "Zentren des Sozialen" (EDK-These 2) bewegt, die wir<br />
Schulen nennen.