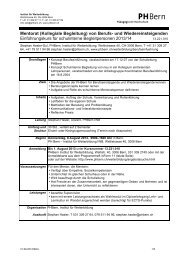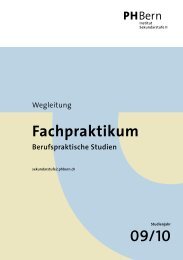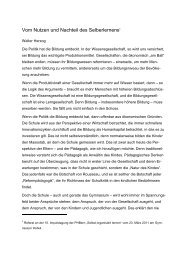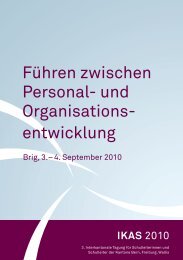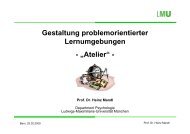Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Professionelles Handeln im Lehrberuf - PHBern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AT 20.04 Sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung und ihr Beitrag zur<br />
Professionalisierung<br />
Fabrikstrasse 2E<br />
Raum 001<br />
Moderation: Caroline Bühler (<strong>PHBern</strong>, Institut Vorschulstufe und<br />
Pr<strong>im</strong>arstufe)<br />
Der schulische Unterricht soll sich an den Erfahrungs- und Lebenswelten der Kinder<br />
orientieren: Dieser Anspruch ist für die konkrete Unterrichtsgestaltung best<strong>im</strong>mend<br />
geworden. Doch was wissen wir über das Leben der Kinder? Welches Wissen braucht die<br />
Lehrperson? Woher soll sie dieses Wissen nehmen?<br />
Die Kinder kommen mit höchst unterschiedlichen biografischen und soziokulturellen<br />
Hintergründen in die Schule. Zeitdiagnosen zeichnen das Bild einer "flüchtigen" und<br />
"übersättigten" Kindheit. Dies lässt den Anspruch auf den angemessenen Einbezug<br />
kindlicher Erfahrung als Illusion erscheinen.<br />
Die neue sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung sorgt für einen Perspektivenwechsel:<br />
Es geht nicht darum, die Bedingungen des Aufwachsens aus Erwachsenensicht zu<br />
kommentieren, sondern die Kinder sollen selber als Akteure wahrgenommen werden und<br />
sich zu ihrer Erfahrungswelt äussern. Das Interesse gilt dem Alltagsleben und den<br />
schulischen und ausserschulischen Erfahrungen der Kinder.<br />
Im Atelier soll diskutiert werden, welchen Beitrag dieser Forschungsbereich zur<br />
Professionalisierung des Berufs leisten kann.<br />
Burkhard Fuhs<br />
(Universität Erfurt, Erziehungswissenschaftliche Fakultät)<br />
Kindheitsforschung und schulische Praxis. Zwei Gegensätze?<br />
Maria Fölling-Albers<br />
(Universität Regensburg, Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik)<br />
Entgrenzung von Schule und Kindheit<br />
Programm Studien- und Kongresswoche 2005<br />
Seite 27<br />
AT 20.05 Lehrpersonen zwischen Belastung und Zufriedenheit<br />
Unitobler,<br />
Lerchenweg 36<br />
Raum F011<br />
Moderation: Ursula Streckeisen (<strong>PHBern</strong>, Institut Sekundar-<br />
stufe I)<br />
Thomas Bieri<br />
(Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung für Didaktik)<br />
Belastung, Belastungsverarbeitung und Zufriedenheit <strong>im</strong> <strong>Lehrberuf</strong><br />
Lehrkräfte klagen über sinkende Löhne und Anerkennung bei steigenden Belastungen und<br />
Anforderungen. Sie beklagen unmögliche Kinder, Zusatzaufgaben, ständiges Herumwerkeln<br />
an der Schule. Andererseits sollen sie es gut haben: viel Lohn und lange Ferien.<br />
Während fünf Jahren hat der Referent Aargauer Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen mit<br />
Fragen zu beruflicher Zufriedenheit, zum Ausmass an empfundenen Belastungen, zur<br />
Belastungsverarbeitung und zu ihrem körperlichen Wohlbefinden konfrontiert. Die ihre<br />
Stelle verlassenden Lehrpersonen wurden nach den Ursachen dieses Schrittes befragt.<br />
Werden neben Belastungen auch andere Einstellungen erhoben, etwa die berufliche<br />
Zufriedenheit oder die Absicht, den <strong>Lehrberuf</strong> <strong>im</strong> Fall einer erneuten Berufswahl wieder zu<br />
ergreifen, relativiert sich das eher düstere Bild der Belastungsstudien.<br />
Der Beitrag geht folgenden Fragen nach: Welche Sachverhalte werden als besonders<br />
belastend oder als nicht belastend eingeschätzt? Verlassen Lehrpersonen ihren Beruf, weil<br />
sie durch ihn stark belastet sind? Sind Lehrpersonen, die nicht kündigen, weniger belastet<br />
und zufriedener als kündigende? Welche weiteren Faktoren spielen eine Rolle? Sind dies<br />
z.B. das Geschlecht, der Lohn, die Klassengrösse? Sind Lehrerinnen oder Lehrer mit ihrem<br />
Beruf zufriedener? Welche Gruppe fühlt sich stärker belastet? Hängt das Ausmass an<br />
empfundenen Belastungen oder die Zufriedenheit vom Schultyp ab, an dem die Lehrpersonen<br />
unterrichten? Oder überwiegen Aspekte des Arbeitsinhaltes?<br />
Es werden Massnahmen zur Belastungsreduktion und Belastungsverarbeitung diskutiert.<br />
Silvio Herzog<br />
(Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Päd. Psychologie)<br />
Beanspruchung und Bewältigung von Lehrpersonen: eine biographische und<br />
salutogenetische Betrachtung<br />
Auf Grund der zunehmenden Destandardisierung traditioneller Berufsbiographien werden<br />
Berufswechsler <strong>im</strong>mer mehr zum Normalfall, dies auch <strong>im</strong> <strong>Lehrberuf</strong>. Die vergleichende<br />
Studie zur Berufskarriere von Absolventinnen und Absolventen der seminaristischen<br />
Ausbildung zur Pr<strong>im</strong>arlehrkraft (s. Hauptreferat Brunner & Herzog am Mittwoch, 19. Okt.,<br />
14.00 Uhr) bietet die Möglichkeit, der Frage nachzugehen, welchen Einfluss ausgewählte<br />
biographische Übergänge auf die Beanspruchung und Bewältigung von Lehrpersonen<br />
haben. Mittels 155 Interviews wurden dazu Erfahrungen mit Unterbrüchen und Reduktionen<br />
der Pr<strong>im</strong>arlehrertätigkeit sowie auch mit Berufswechseln <strong>im</strong> biographischen Kontext der<br />
verschiedenen "Bewältigungsgeschichten" erfasst. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, in<br />
welcher Weise veränderte berufliche Rahmenbedingungen individuelle Prozesse prägen.<br />
Auf dieser Grundlage lassen sich bedeutsame Folgerungen für die Aus- und Weiterbildung<br />
von Lehrpersonen sowie die Gestaltung des Berufsauftrags und der Rahmenbedingungen<br />
für die Ausübung der Lehrertätigkeit ableiten.