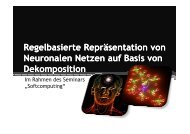Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 <strong>Die</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Rechenmaschinen</strong><br />
___________________________________________________________________________<br />
7.5.6 Philipp Matthäus Hahn<br />
Philipp Matthäus Hahn wurde am<br />
25.11..1739 in Ostfildern-Scharnhausen bei<br />
Stuttgart als zweites von zehn Kindern<br />
geboren. Von 1749 bis 1754 besuchte er die<br />
Lateinschule in Esslingen und in Nürtingen.<br />
Von 1776 bis 1760 studierte er an der<br />
Universität Tübingen Theologie. Nach dem<br />
Vikariat erhielt er bereits 1764 im Alter von<br />
25 Jahren seine erste Pfarrstelle in<br />
Onstmettingen auf der Schwäbischen Alb. Im<br />
Jahre 1774 starb seine Frau Anna Maria bei<br />
der Geburt ihres siebten Kindes. Ein Jahr<br />
später heiratete er Beata Regina, eine Tochter<br />
des Pfarrer-Originals Johann Friedrich<br />
Flattich, mit der er noch weitere Kinder<br />
hatte.<br />
Schon früh zeigte er ein ausgeprägtes<br />
Interesse für Himmelsbeobachtungen und<br />
technische Geräte.<br />
Abb. 7.42 Philipp Matthäus Hahn<br />
In Instmettingen richtete er sich eine Werkstatt ein für den Bau von Waagen, Uhren und<br />
astronomischen Maschinen ein. Hierbei half ihm sein Jugendfreund Philipp Gottfried<br />
Schaudt, der die handwerkliche Umsetzung seiner Konstruktionen übernahm. <strong>Die</strong> erste aus<br />
Messing und Eisen gefertigte astronomische Uhr ließ sich der Landesherr, Herzog Carl<br />
Eugen, vorführen, und bestellte anschließend eine größere Maschine für die Bibliothek des<br />
Ludwigsburger Schlosses. Herzog Carl Eugen, der ihn als „Uhrmacher Gottes“ bezeichnete,<br />
sorgte auch dafür, dass er 1781 eine Pfarrei in Echterdingen übernehmen konnte, wo er am 2.<br />
Mai 1790 verstarb. Wie aus seinen Tagebüchern ersichtlich ist, nahm er seinen Beruf als<br />
Pfarrer sehr ernst. So nahm er sich die Zeit, seine theologischen Gedanken und seine<br />
Predigten für den Druck vorzubereiten; dies auch dann noch, als ihm von seiner<br />
Kirchenbehörde ein Publikationsverbot auferlegt wurde. <strong>Die</strong> Werkstattarbeit betrieb er<br />
nebenher als Hobby und als Ablenkung von seinen theologischen Studien, aber doch "zum<br />
Ruhme Gottes". Er selbst erfand, entwickelte und konstruierte die Produkte, und seine<br />
Mechanikern setzten sie dann in konkrete Objekte um. So entstanden in der Werkstatt u.a.<br />
Neigungswaagen, Sonnenuhren, Großuhren, Taschenuhren und <strong>Rechenmaschinen</strong>.<br />
So wurde er durch seine speziellen Sonnenuhren<br />
bekannt, deren erstes Exemplar 1763 entstand. Bei diesem<br />
Typ, der Öhrsonnenuhr, erfolgte die Einstellung der<br />
Pohlhöhe an einem kardanisch aufgehängten, Meridianring.<br />
An einem drehbaren Rahmen, der in diesem Meridianring<br />
parallel zur Erdachse gelagert ist, ist auf einer Seite innen<br />
die Zeitgleichungskurve angebracht.<br />
Abb. 7.43 Schema der Öhrsonnenuhr<br />
207