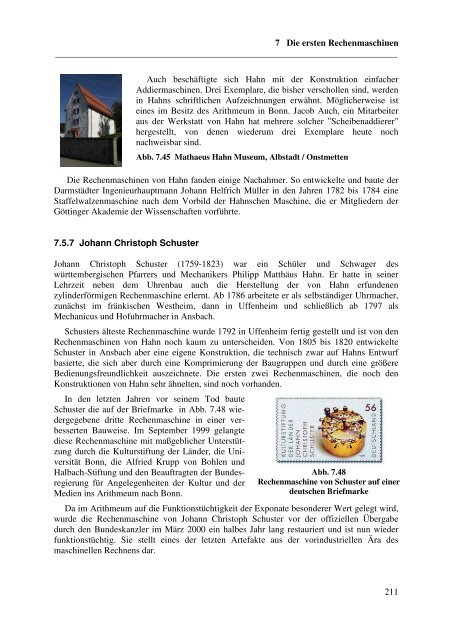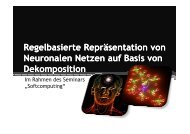Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Kap. 7 Die ersten Rechenmaschinen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7 <strong>Die</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Rechenmaschinen</strong><br />
___________________________________________________________________________<br />
<strong>Die</strong> <strong>Rechenmaschinen</strong> von Hahn fanden einige Nachahmer. So entwickelte und baute der<br />
Darmstädter Ingenieurhauptmann Johann Helfrich Müller in den Jahren 1782 bis 1784 eine<br />
Staffelwalzenmaschine nach dem Vorbild der Hahnschen Maschine, die er Mitgliedern der<br />
Göttinger Akademie der Wissenschaften vorführte.<br />
7.5.7 Johann Christoph Schuster<br />
Auch beschäftigte sich Hahn mit der Konstruktion einfacher<br />
Addiermaschinen. Drei Exemplare, die bisher verschollen sind, werden<br />
in Hahns schriftlichen Aufzeichnungen erwähnt. Möglicherweise ist<br />
eines im Besitz des Arithmeum in Bonn. Jacob Auch, ein Mitarbeiter<br />
aus der Werkstatt von Hahn hat mehrere solcher "Scheibenaddierer"<br />
hergestellt, von denen wiederum drei Exemplare heute noch<br />
nachweisbar sind.<br />
Abb. 7.45 Mathaeus Hahn Museum, Albstadt / Onstmetten<br />
Johann Christoph Schuster (1759-1823) war ein Schüler und Schwager des<br />
württembergischen Pfarrers und Mechanikers Philipp Matthäus Hahn. Er hatte in seiner<br />
Lehrzeit neben dem Uhrenbau auch die Herstellung der von Hahn erfundenen<br />
zylinderförmigen Rechenmaschine erlernt. Ab 1786 arbeitete er als selbständiger Uhrmacher,<br />
zunächst im fränkischen Westheim, dann in Uffenheim und schließlich ab 1797 als<br />
Mechanicus und Hofuhrmacher in Ansbach.<br />
Schusters älteste Rechenmaschine wurde 1792 in Uffenheim fertig gestellt und ist von den<br />
<strong>Rechenmaschinen</strong> von Hahn noch kaum zu unterscheiden. Von 1805 bis 1820 entwickelte<br />
Schuster in Ansbach aber eine eigene Konstruktion, die technisch zwar auf Hahns Entwurf<br />
basierte, die sich aber durch eine Komprimierung der Baugruppen und durch eine größere<br />
Bedienungsfreundlichkeit auszeichnete. <strong>Die</strong> <strong>ersten</strong> zwei <strong>Rechenmaschinen</strong>, die noch den<br />
Konstruktionen von Hahn sehr ähnelten, sind noch vorhanden.<br />
In den letzten Jahren vor seinem Tod baute<br />
Schuster die auf der Briefmarke in Abb. 7.48 wiedergegebene<br />
dritte Rechenmaschine in einer verbesserten<br />
Bauweise. Im September 1999 gelangte<br />
diese Rechenmaschine mit maßgeblicher Unterstützung<br />
durch die Kulturstiftung der Länder, die Universität<br />
Bonn, die Alfried Krupp von Bohlen und<br />
Halbach-Stiftung und den Beauftragten der Bundesregierung<br />
für Angelegenheiten der Kultur und der<br />
Medien ins Arithmeum nach Bonn.<br />
Abb. 7.48<br />
Rechenmaschine von Schuster auf einer<br />
deutschen Briefmarke<br />
Da im Arithmeum auf die Funktionstüchtigkeit der Exponate besonderer Wert gelegt wird,<br />
wurde die Rechenmaschine von Johann Christoph Schuster vor der offiziellen Übergabe<br />
durch den Bundeskanzler im März 2000 ein halbes Jahr lang restauriert und ist nun wieder<br />
funktionstüchtig. Sie stellt eines der letzten Artefakte aus der vorindustriellen Ära des<br />
maschinellen Rechnens dar.<br />
211