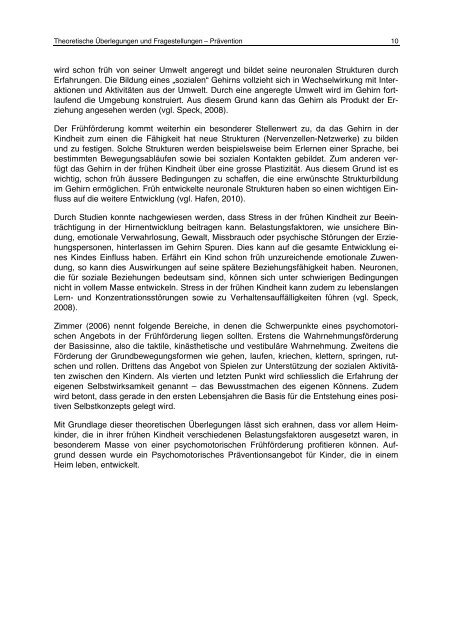Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretische Überlegungen und Fragestellungen – Prävention 10<br />
wird schon früh von seiner Umwelt angeregt und bildet seine neuronalen Strukturen durch<br />
Erfahrungen. Die Bildung eines „sozialen“ Gehirns vollzieht sich in Wechselwirkung mit Interaktionen<br />
und Aktivitäten aus der Umwelt. Durch eine angeregte Umwelt wird im Gehirn fortlaufend<br />
die Umgebung konstruiert. Aus diesem Grund kann das Gehirn als Produkt der Erziehung<br />
angesehen werden (vgl. Speck, 2008).<br />
Der Frühförderung kommt weiterhin ein besonderer Stellenwert zu, da das Gehirn in der<br />
Kindheit zum einen die Fähigkeit hat neue Strukturen (Nervenzellen-Netzwerke) zu bilden<br />
und zu festigen. Solche Strukturen werden beispielsweise beim Erlernen einer Sprache, bei<br />
bestimmten Bewegungsabläufen sowie bei sozialen Kontakten gebildet. Zum anderen verfügt<br />
das Gehirn in der frühen Kindheit über eine grosse Plastizität. Aus diesem Grund ist es<br />
wichtig, schon früh äussere Bedingungen zu schaffen, die eine erwünschte Strukturbildung<br />
im Gehirn ermöglichen. Früh entwickelte neuronale Strukturen haben so einen wichtigen Einfluss<br />
auf die weitere Entwicklung (vgl. Hafen, 2010).<br />
Durch Studien konnte nachgewiesen werden, dass Stress in der frühen Kindheit zur Beeinträchtigung<br />
in der Hirnentwicklung beitragen kann. Belastungsfaktoren, wie unsichere Bindung,<br />
emotionale Verwahrlosung, Gewalt, Missbrauch oder psychische Störungen der Erziehungspersonen,<br />
hinterlassen im Gehirn Spuren. Dies kann auf die gesamte Entwicklung eines<br />
Kindes Einfluss haben. Erfährt ein Kind schon früh unzureichende emotionale Zuwendung,<br />
so kann dies Auswirkungen auf seine spätere Beziehungsfähigkeit haben. Neuronen,<br />
die für soziale Beziehungen bedeutsam sind, können sich unter schwierigen Bedingungen<br />
nicht in vollem Masse entwickeln. Stress in der frühen Kindheit kann zudem zu lebenslangen<br />
Lern- und Konzentrationsstörungen sowie zu Verhaltensauffälligkeiten führen (vgl. Speck,<br />
2008).<br />
Zimmer (2006) nennt folgende Bereiche, in denen die Schwerpunkte eines psychomotorischen<br />
Angebots in der Frühförderung liegen sollten. Erstens die Wahrnehmungsförderung<br />
der Basissinne, also die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung. Zweitens die<br />
Förderung der Grundbewegungsformen wie gehen, laufen, kriechen, klettern, springen, rutschen<br />
und rollen. Drittens das Angebot von Spielen zur Unterstützung der sozialen Aktivitäten<br />
zwischen den Kindern. Als vierten und letzten Punkt wird schliesslich die Erfahrung der<br />
eigenen Selbstwirksamkeit genannt – das Bewusstmachen des eigenen Könnens. Zudem<br />
wird betont, dass gerade in den ersten Lebensjahren die Basis für die Entstehung eines positiven<br />
Selbstkonzepts gelegt wird.<br />
Mit Grundlage dieser theoretischen Überlegungen lässt sich erahnen, dass vor allem <strong>Heimkinder</strong>,<br />
die in ihrer frühen Kindheit verschiedenen Belastungsfaktoren ausgesetzt waren, in<br />
besonderem Masse von einer psychomotorischen Frühförderung profitieren können. Aufgrund<br />
dessen wurde ein Psychomotorisches Präventionsangebot für Kinder, die in einem<br />
Heim leben, entwickelt.