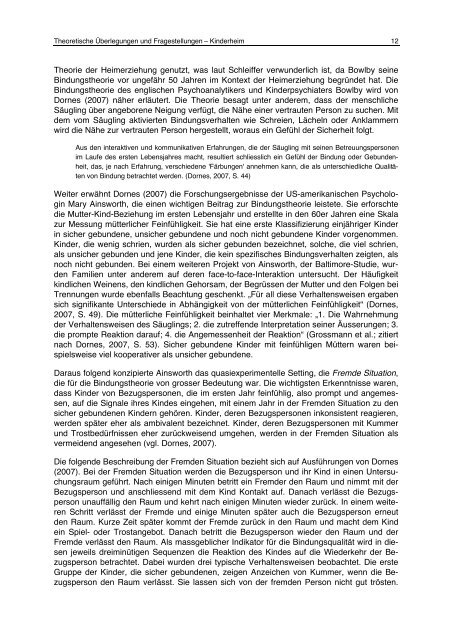Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Theoretische Überlegungen und Fragestellungen – Kinderheim 12<br />
Theorie der Heimerziehung genutzt, was laut Schleiffer verwunderlich ist, da Bowlby seine<br />
Bindungstheorie vor ungefähr 50 Jahren im Kontext der Heimerziehung begründet hat. Die<br />
Bindungstheorie des englischen Psychoanalytikers und Kinderpsychiaters Bowlby wird von<br />
Dornes (2007) näher erläutert. Die Theorie besagt unter anderem, dass der menschliche<br />
Säugling über angeborene Neigung verfügt, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen. Mit<br />
dem vom Säugling aktivierten Bindungsverhalten wie Schreien, Lächeln oder Anklammern<br />
wird die Nähe zur vertrauten Person hergestellt, woraus ein Gefühl der Sicherheit folgt.<br />
Aus den interaktiven und kommunikativen Erfahrungen, die der Säugling mit seinen Betreuungspersonen<br />
im Laufe des ersten Lebensjahres macht, resultiert schliesslich ein Gefühl der Bindung oder Gebundenheit,<br />
das, je nach Erfahrung, verschiedene 'Färbungen' annehmen kann, die als unterschiedliche Qualitäten<br />
von Bindung betrachtet werden. (Dornes, 2007, S. 44)<br />
Weiter erwähnt Dornes (2007) die Forschungsergebnisse der US-amerikanischen Psychologin<br />
Mary Ainsworth, die einen wichtigen Beitrag zur Bindungstheorie leistete. Sie erforschte<br />
die Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr und erstellte in den 60er Jahren eine Skala<br />
zur Messung mütterlicher Feinfühligkeit. Sie hat eine erste Klassifizierung einjähriger Kinder<br />
in sicher gebundene, unsicher gebundene und noch nicht gebundene Kinder vorgenommen.<br />
Kinder, die wenig schrien, wurden als sicher gebunden bezeichnet, solche, die viel schrien,<br />
als unsicher gebunden und jene Kinder, die kein spezifisches Bindungsverhalten zeigten, als<br />
noch nicht gebunden. Bei einem weiteren Projekt von Ainsworth, der Baltimore-Studie, wurden<br />
Familien unter anderem auf deren face-to-face-Interaktion untersucht. Der Häufigkeit<br />
kindlichen Weinens, den kindlichen Gehorsam, der Begrüssen der Mutter und den Folgen bei<br />
Trennungen wurde ebenfalls Beachtung geschenkt. „Für all diese Verhaltensweisen ergaben<br />
sich signifikante Unterschiede in Abhängigkeit von der mütterlichen Feinfühligkeit“ (Dornes,<br />
2007, S. 49). Die mütterliche Feinfühligkeit beinhaltet vier Merkmale: „1. Die Wahrnehmung<br />
der Verhaltensweisen des Säuglings; 2. die zutreffende Interpretation seiner Äusserungen; 3.<br />
die prompte Reaktion darauf; 4. die Angemessenheit der Reaktion“ (Grossmann et al.; zitiert<br />
nach Dornes, 2007, S. 53). Sicher gebundene Kinder mit feinfühligen Müttern waren beispielsweise<br />
viel kooperativer als unsicher gebundene.<br />
Daraus folgend konzipierte Ainsworth das quasiexperimentelle Setting, die Fremde Situation,<br />
die für die Bindungstheorie von grosser Bedeutung war. Die wichtigsten Erkenntnisse waren,<br />
dass Kinder von Bezugspersonen, die im ersten Jahr feinfühlig, also prompt und angemessen,<br />
auf die Signale ihres Kindes eingehen, mit einem Jahr in der Fremden Situation zu den<br />
sicher gebundenen Kindern gehören. Kinder, deren Bezugspersonen inkonsistent reagieren,<br />
werden später eher als ambivalent bezeichnet. Kinder, deren Bezugspersonen mit Kummer<br />
und Trostbedürfnissen eher zurückweisend umgehen, werden in der Fremden Situation als<br />
vermeidend angesehen (vgl. Dornes, 2007).<br />
Die folgende Beschreibung der Fremden Situation bezieht sich auf Ausführungen von Dornes<br />
(2007). Bei der Fremden Situation werden die Bezugsperson und ihr Kind in einen Untersuchungsraum<br />
geführt. Nach einigen Minuten betritt ein Fremder den Raum und nimmt mit der<br />
Bezugsperson und anschliessend mit dem Kind Kontakt auf. Danach verlässt die Bezugsperson<br />
unauffällig den Raum und kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. In einem weiteren<br />
Schritt verlässt der Fremde und einige Minuten später auch die Bezugsperson erneut<br />
den Raum. Kurze Zeit später kommt der Fremde zurück in den Raum und macht dem Kind<br />
ein Spiel- oder Trostangebot. Danach betritt die Bezugsperson wieder den Raum und der<br />
Fremde verlässt den Raum. Als massgeblicher Indikator für die Bindungsqualität wird in diesen<br />
jeweils dreiminütigen Sequenzen die Reaktion des Kindes auf die Wiederkehr der Bezugsperson<br />
betrachtet. Dabei wurden drei typische Verhaltensweisen beobachtet. Die erste<br />
Gruppe der Kinder, die sicher gebundenen, zeigen Anzeichen von Kummer, wenn die Bezugsperson<br />
den Raum verlässt. Sie lassen sich von der fremden Person nicht gut trösten.