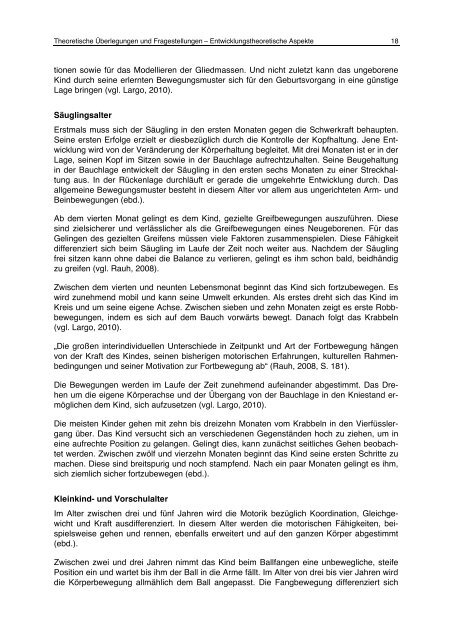Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretische Überlegungen und Fragestellungen – Entwicklungstheoretische Aspekte 18<br />
tionen sowie für das Modellieren der Gliedmassen. Und nicht zuletzt kann das ungeborene<br />
Kind durch seine erlernten Bewegungsmuster sich für den Geburtsvorgang in eine günstige<br />
Lage bringen (vgl. Largo, 2010).<br />
Säuglingsalter<br />
Erstmals muss sich der Säugling in den ersten Monaten gegen die Schwerkraft behaupten.<br />
Seine ersten Erfolge erzielt er diesbezüglich durch die Kontrolle der Kopfhaltung. Jene Entwicklung<br />
wird von der Veränderung der Körperhaltung begleitet. Mit drei Monaten ist er in der<br />
Lage, seinen Kopf im Sitzen sowie in der Bauchlage aufrechtzuhalten. Seine Beugehaltung<br />
in der Bauchlage entwickelt der Säugling in den ersten sechs Monaten zu einer Streckhaltung<br />
aus. In der Rückenlage durchläuft er gerade die umgekehrte Entwicklung durch. Das<br />
allgemeine Bewegungsmuster besteht in diesem Alter vor allem aus ungerichteten Arm- und<br />
Beinbewegungen (ebd.).<br />
Ab dem vierten Monat gelingt es dem Kind, gezielte Greifbewegungen auszuführen. Diese<br />
sind zielsicherer und verlässlicher als die Greifbewegungen eines Neugeborenen. Für das<br />
Gelingen des gezielten Greifens müssen viele Faktoren zusammenspielen. Diese Fähigkeit<br />
differenziert sich beim Säugling im Laufe der Zeit noch weiter aus. Nachdem der Säugling<br />
frei sitzen kann ohne dabei die Balance zu verlieren, gelingt es ihm schon bald, beidhändig<br />
zu greifen (vgl. Rauh, 2008).<br />
Zwischen dem vierten und neunten Lebensmonat beginnt das Kind sich fortzubewegen. Es<br />
wird zunehmend mobil und kann seine Umwelt erkunden. Als erstes dreht sich das Kind im<br />
Kreis und um seine eigene Achse. Zwischen sieben und zehn Monaten zeigt es erste Robbbewegungen,<br />
indem es sich auf dem Bauch vorwärts bewegt. Danach folgt das Krabbeln<br />
(vgl. Largo, 2010).<br />
„Die großen interindividuellen Unterschiede in Zeitpunkt und Art der Fortbewegung hängen<br />
von der Kraft des Kindes, seinen bisherigen motorischen Erfahrungen, kulturellen Rahmenbedingungen<br />
und seiner Motivation zur Fortbewegung ab“ (Rauh, 2008, S. 181).<br />
Die Bewegungen werden im Laufe der Zeit zunehmend aufeinander abgestimmt. Das Drehen<br />
um die eigene Körperachse und der Übergang von der Bauchlage in den Kniestand ermöglichen<br />
dem Kind, sich aufzusetzen (vgl. Largo, 2010).<br />
Die meisten Kinder gehen mit zehn bis dreizehn Monaten vom Krabbeln in den Vierfüsslergang<br />
über. Das Kind versucht sich an verschiedenen Gegenständen hoch zu ziehen, um in<br />
eine aufrechte Position zu gelangen. Gelingt dies, kann zunächst seitliches Gehen beobachtet<br />
werden. Zwischen zwölf und vierzehn Monaten beginnt das Kind seine ersten Schritte zu<br />
machen. Diese sind breitspurig und noch stampfend. Nach ein paar Monaten gelingt es ihm,<br />
sich ziemlich sicher fortzubewegen (ebd.).<br />
Kleinkind- und Vorschulalter<br />
Im Alter zwischen drei und fünf Jahren wird die Motorik bezüglich Koordination, Gleichgewicht<br />
und Kraft ausdifferenziert. In diesem Alter werden die motorischen Fähigkeiten, beispielsweise<br />
gehen und rennen, ebenfalls erweitert und auf den ganzen Körper abgestimmt<br />
(ebd.).<br />
Zwischen zwei und drei Jahren nimmt das Kind beim Ballfangen eine unbewegliche, steife<br />
Position ein und wartet bis ihm der Ball in die Arme fällt. Im Alter von drei bis vier Jahren wird<br />
die Körperbewegung allmählich dem Ball angepasst. Die Fangbewegung differenziert sich