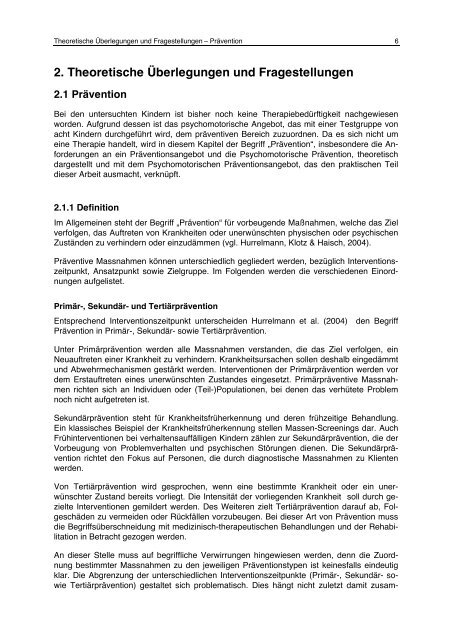Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretische Überlegungen und Fragestellungen – Prävention 6<br />
2. Theoretische Überlegungen und Fragestellungen<br />
2.1 Prävention<br />
Bei den untersuchten Kindern ist bisher noch keine Therapiebedürftigkeit nachgewiesen<br />
worden. Aufgrund dessen ist das psychomotorische Angebot, das mit einer Testgruppe von<br />
acht Kindern durchgeführt wird, dem präventiven Bereich zuzuordnen. Da es sich nicht um<br />
eine Therapie handelt, wird in diesem Kapitel der Begriff „Prävention“, insbesondere die Anforderungen<br />
an ein Präventionsangebot und die Psychomotorische Prävention, theoretisch<br />
dargestellt und mit dem Psychomotorischen Präventionsangebot, das den praktischen Teil<br />
dieser Arbeit ausmacht, verknüpft.<br />
2.1.1 Definition<br />
Im Allgemeinen steht der Begriff „Prävention“ für vorbeugende Maßnahmen, welche das Ziel<br />
verfolgen, das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen<br />
Zuständen zu verhindern oder einzudämmen (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2004).<br />
Präventive Massnahmen können unterschiedlich gegliedert werden, bezüglich Interventionszeitpunkt,<br />
Ansatzpunkt sowie Zielgruppe. Im Folgenden werden die verschiedenen Einordnungen<br />
aufgelistet.<br />
Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention<br />
Entsprechend Interventionszeitpunkt unterscheiden Hurrelmann et al. (2004) den Begriff<br />
Prävention in Primär-, Sekundär- sowie Tertiärprävention.<br />
Unter Primärprävention werden alle Massnahmen verstanden, die das Ziel verfolgen, ein<br />
Neuauftreten einer Krankheit zu verhindern. Krankheitsursachen sollen deshalb eingedämmt<br />
und Abwehrmechanismen gestärkt werden. Interventionen der Primärprävention werden vor<br />
dem Erstauftreten eines unerwünschten Zustandes eingesetzt. Primärpräventive Massnahmen<br />
richten sich an Individuen oder (Teil-)Populationen, bei denen das verhütete Problem<br />
noch nicht aufgetreten ist.<br />
Sekundärprävention steht für Krankheitsfrüherkennung und deren frühzeitige Behandlung.<br />
Ein klassisches Beispiel der Krankheitsfrüherkennung stellen Massen-Screenings dar. Auch<br />
Frühinterventionen bei verhaltensauffälligen Kindern zählen zur Sekundärprävention, die der<br />
Vorbeugung von Problemverhalten und psychischen Störungen dienen. Die Sekundärprävention<br />
richtet den Fokus auf Personen, die durch diagnostische Massnahmen zu Klienten<br />
werden.<br />
Von Tertiärprävention wird gesprochen, wenn eine bestimmte Krankheit oder ein unerwünschter<br />
Zustand bereits vorliegt. Die Intensität der vorliegenden Krankheit soll durch gezielte<br />
Interventionen gemildert werden. Des Weiteren zielt Tertiärprävention darauf ab, Folgeschäden<br />
zu vermeiden oder Rückfällen vorzubeugen. Bei dieser Art von Prävention muss<br />
die Begriffsüberschneidung mit medizinisch-therapeutischen Behandlungen und der Rehabilitation<br />
in Betracht gezogen werden.<br />
An dieser Stelle muss auf begriffliche Verwirrungen hingewiesen werden, denn die Zuordnung<br />
bestimmter Massnahmen zu den jeweiligen Präventionstypen ist keinesfalls eindeutig<br />
klar. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Interventionszeitpunkte (Primär-, Sekundär- sowie<br />
Tertiärprävention) gestaltet sich problematisch. Dies hängt nicht zuletzt damit zusam-