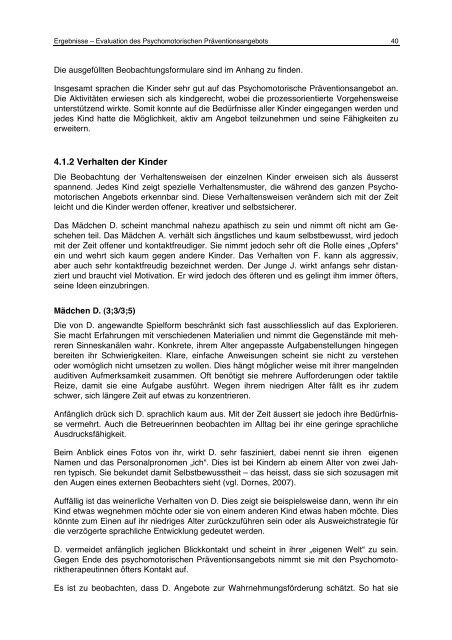Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Entwicklungsverzögerte Heimkinder? - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ergebnisse – Evaluation des Psychomotorischen Präventionsangebots 40<br />
Die ausgefüllten Beobachtungsformulare sind im Anhang zu finden.<br />
Insgesamt sprachen die Kinder sehr gut auf das Psychomotorische Präventionsangebot an.<br />
Die Aktivitäten erwiesen sich als kindgerecht, wobei die prozessorientierte Vorgehensweise<br />
unterstützend wirkte. Somit konnte auf die Bedürfnisse aller Kinder eingegangen werden und<br />
jedes Kind hatte die Möglichkeit, aktiv am Angebot teilzunehmen und seine Fähigkeiten zu<br />
erweitern.<br />
4.1.2 Verhalten der Kinder<br />
Die Beobachtung der Verhaltensweisen der einzelnen Kinder erweisen sich als äusserst<br />
spannend. Jedes Kind zeigt spezielle Verhaltensmuster, die während des ganzen Psychomotorischen<br />
Angebots erkennbar sind. Diese Verhaltensweisen verändern sich mit der Zeit<br />
leicht und die Kinder werden offener, kreativer und selbstsicherer.<br />
Das Mädchen D. scheint manchmal nahezu apathisch zu sein und nimmt oft nicht am Geschehen<br />
teil. Das Mädchen A. verhält sich ängstliches und kaum selbstbewusst, wird jedoch<br />
mit der Zeit offener und kontaktfreudiger. Sie nimmt jedoch sehr oft die Rolle eines „Opfers“<br />
ein und wehrt sich kaum gegen andere Kinder. Das Verhalten von F. kann als aggressiv,<br />
aber auch sehr kontaktfreudig bezeichnet werden. Der Junge J. wirkt anfangs sehr distanziert<br />
und braucht viel Motivation. Er wird jedoch des öfteren und es gelingt ihm immer öfters,<br />
seine Ideen einzubringen.<br />
Mädchen D. (3;3/3;5)<br />
Die von D. angewandte Spielform beschränkt sich fast ausschliesslich auf das Explorieren.<br />
Sie macht Erfahrungen mit verschiedenen Materialien und nimmt die Gegenstände mit mehreren<br />
Sinneskanälen wahr. Konkrete, ihrem Alter angepasste Aufgabenstellungen hingegen<br />
bereiten ihr Schwierigkeiten. Klare, einfache Anweisungen scheint sie nicht zu verstehen<br />
oder womöglich nicht umsetzen zu wollen. Dies hängt möglicher weise mit ihrer mangelnden<br />
auditiven Aufmerksamkeit zusammen. Oft benötigt sie mehrere Aufforderungen oder taktile<br />
Reize, damit sie eine Aufgabe ausführt. Wegen ihrem niedrigen Alter fällt es ihr zudem<br />
schwer, sich längere Zeit auf etwas zu konzentrieren.<br />
Anfänglich drück sich D. sprachlich kaum aus. Mit der Zeit äussert sie jedoch ihre Bedürfnisse<br />
vermehrt. Auch die Betreuerinnen beobachten im Alltag bei ihr eine geringe sprachliche<br />
Ausdrucksfähigkeit.<br />
Beim Anblick eines Fotos von ihr, wirkt D. sehr fasziniert, dabei nennt sie ihren eigenen<br />
Namen und das Personalpronomen „ich“. Dies ist bei Kindern ab einem Alter von zwei Jahren<br />
typisch. Sie bekundet damit Selbstbewusstheit – das heisst, dass sie sich sozusagen mit<br />
den Augen eines externen Beobachters sieht (vgl. Dornes, 2007).<br />
Auffällig ist das weinerliche Verhalten von D. Dies zeigt sie beispielsweise dann, wenn ihr ein<br />
Kind etwas wegnehmen möchte oder sie von einem anderen Kind etwas haben möchte. Dies<br />
könnte zum Einen auf ihr niedriges Alter zurückzuführen sein oder als Ausweichstrategie für<br />
die verzögerte sprachliche Entwicklung gedeutet werden.<br />
D. vermeidet anfänglich jeglichen Blickkontakt und scheint in ihrer „eigenen Welt“ zu sein.<br />
Gegen Ende des psychomotorischen Präventionsangebots nimmt sie mit den Psychomotoriktherapeutinnen<br />
öfters Kontakt auf.<br />
Es ist zu beobachten, dass D. Angebote zur Wahrnehmungsförderung schätzt. So hat sie