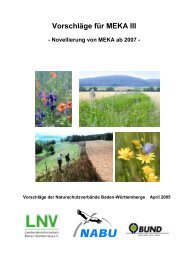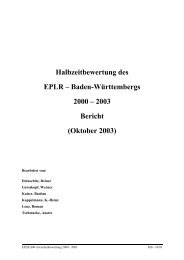EU-Agrarpolitik nach 2013 - Bundesministerium der Finanzen
EU-Agrarpolitik nach 2013 - Bundesministerium der Finanzen
EU-Agrarpolitik nach 2013 - Bundesministerium der Finanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
a) Klimawandel<br />
59. Der Klimawandel kann erhebliche Auswirkungen auf die künftige Entwicklung <strong>der</strong> Land-<br />
und Forstwirtschaft haben. Für Europa wird erwartet, dass die Agrarsektoren im südlichen<br />
Teil <strong>der</strong> <strong>EU</strong> tendenziell negativ betroffen sein werden, im nördlichen Teil tendenziell positiv.<br />
Wahrscheinlich än<strong>der</strong>n sich die klimatischen Verhältnisse in Deutschland weniger stark als in<br />
vielen an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Welt. Da die erwarteten Än<strong>der</strong>ungen für die globale Agrarproduktion<br />
überwiegend negativ sind, könnte dies bedeuten, dass sich <strong>der</strong> Klimawandel für<br />
die deutsche Landwirtschaft per saldo stärker in Gestalt steigen<strong>der</strong> Agrarpreise bemerkbar<br />
machen wird als in Gestalt ungünstigerer Ertragsbedingungen vor Ort.<br />
60. Der Landwirtschaft stehen grundsätzlich zahlreiche Handlungsoptionen zur Verfügung,<br />
mit denen sie sich an verän<strong>der</strong>te Klimabedingungen, Verän<strong>der</strong>ungen des Schädlings- und<br />
Pathogenregimes sowie verän<strong>der</strong>te Preisrelationen anpassen kann. In aller Regel können<br />
die Unternehmen vor Ort unter dem Eindruck <strong>der</strong> standörtlichen Rahmenbedingungen am<br />
besten entscheiden, wo und wann welche Anpassungsoption vorteilhaft ist. Insofern sind die<br />
staatlichen Aufgaben in diesem Bereich begrenzt. Sie betreffen vor allem (a) die Schaffung<br />
einer guten wissenschaftlichen Entscheidungsbasis sowie Infrastruktur für die Prognose <strong>der</strong><br />
Klima- und Wetterverhältnisse, (b) den Ausbau effektiver Einfuhrkontrollen in Bezug auf<br />
Schädlinge, Pathogene sowie an<strong>der</strong>e gebietsfremde Organismen, (c) die För<strong>der</strong>ung von<br />
produktionstechnischen Entwicklungen, mit denen sich die Unternehmen an verän<strong>der</strong>te<br />
Bedingungen anpassen können, (d) die För<strong>der</strong>ung überbetrieblicher Investitionsmaßnahmen,<br />
beispielsweise im Bereich <strong>der</strong> Wasserspeicherung, und eventuell auch (e) eine<br />
Anschubhilfe zur Etablierung von Versicherungslösungen, mit denen sich die Unternehmen<br />
auf zunehmende Wetterrisiken einstellen können.<br />
61. Die Forstwirtschaft hat aufgrund ihrer langen Produktionszyklen naturgemäß wesentlich<br />
größere Schwierigkeiten, auf Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> natürlichen Rahmenbedingungen zu reagieren.<br />
Insofern besteht hier ein wesentlich dringen<strong>der</strong>er Handlungsbedarf als in <strong>der</strong> Landwirtschaft.<br />
Staatliche Maßnahmen zur Unterstützung privatwirtschaftlicher Anpassungsmaßnahmen<br />
sollten deshalb zunächst verstärkt in diesen Wirtschaftszweig gelenkt werden.<br />
62. Zum Klimaschutz: In welchem Maße Land- und Forstwirtschaft von den internationalen<br />
Klimaschutzabkommen betroffen sein werden, lässt sich <strong>der</strong>zeit noch nicht verlässlich<br />
abschätzen. Erstens ist <strong>nach</strong> dem Ausgang <strong>der</strong> Kopenhagen-Konferenz unklar, ob und wann<br />
sich die Staatengemeinschaft überhaupt auf sanktionierte Min<strong>der</strong>ungsziele für die anthropogenen<br />
Treibhausgas(THG)-Emissionen einigen wird, wie ambitioniert diese Ziele formuliert<br />
werden und wie ambitioniert die <strong>EU</strong> ggf. ihre Klimaschutzstrategie auch unilateral fortsetzen<br />
würde. Zweitens ist unklar, zu welchem Zeitpunkt welche „agrarbürtigen“ Emissionen in die<br />
THG-Min<strong>der</strong>ungsverpflichtungen einbezogen werden können und in welchem Umfang nationale<br />
Regierungen hiervon Gebrauch machen werden. Und drittens lässt sich <strong>der</strong>zeit noch<br />
nicht abschätzen, wie die nationalen Regierungen ihre nationalen THG-Min<strong>der</strong>ungsziele<br />
dann auf die einzelnen Emissionsquellen bzw. Sektoren aufteilen werden. Im Hinblick auf die<br />
aus dem Kyoto-Protokoll resultierenden THG-Min<strong>der</strong>ungsverpflichtungen <strong>der</strong> <strong>EU</strong> bzw.<br />
Deutschlands werden bisher nur die drei direkten Emissionsquellen angerechnet: Fermentation<br />
bei <strong>der</strong> Verdauung (CH4), Wirtschaftsdüngermanagement (CH4 und N2O) und landwirt-<br />
15