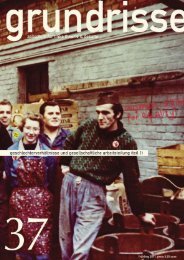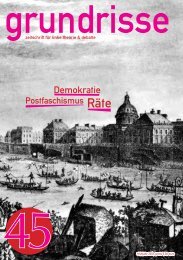Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Karl Reitter | Marx & Spinoza<br />
her<strong>aus</strong> tätig sind, dann handeln wir <strong>und</strong> streben nach<br />
Vollkommenheit, wenn nicht, dann nicht.<br />
Spinoza verwendet nun für das bloße Tätigsein,<br />
welches nicht <strong>aus</strong> unserer Natur folgt, den Begriff<br />
Erleiden. Orientieren wir uns am üblichen Wortsinn,<br />
so sind Missverständnisse unvermeidbar. Der<br />
Gegensatz von Handeln <strong>und</strong> Erleiden ist keineswegs<br />
mit dem Gegensatz von Aktivität <strong>und</strong> Passivität<br />
identisch. Wohl schließt <strong>der</strong> Begriff des<br />
Handelns stets Aktivität ein, doch auch die Affekte<br />
des Leidens führen zu Aktivitäten. Diese Aktivitäten<br />
des Erleidens sind jedoch von wirklichen Handlungen<br />
klar zu unterscheiden. Wir handeln deshalb<br />
nicht, weil wir zwar glauben, dass wir unser Sein erhalten,<br />
tatsächlich gefährden wir es stattdessen. Wir<br />
handeln nur dann, wenn unsere Aktivitäten einzig<br />
<strong>und</strong> allein <strong>aus</strong> dem Streben folgen, unser Sein zu erhalten,<br />
wenn <strong>aus</strong>schließlich wir die Ursache unserer<br />
Aktivitäten sind. „Ich sage, dass wir dann handeln,<br />
wenn etwas in uns geschieht o<strong>der</strong> außer uns geschieht,<br />
dessen adäquate Ursache wir sind.“ (3def2)<br />
Adäquate Ursache zu sein bedeutet die einzige <strong>und</strong><br />
daher klar erkennbare Ursache zu sein. Ich komme<br />
nun zur entscheidenden Frage: Was hin<strong>der</strong>t uns<br />
nach Spinoza am Handeln? Diese Frage ist identisch<br />
mit <strong>der</strong> Frage: Was hin<strong>der</strong>t uns an <strong>der</strong> Freiheit,<br />
was hin<strong>der</strong>t uns an <strong>der</strong> Selbstbestimmung, was<br />
an <strong>der</strong> Tugend?<br />
Erstens: unser Eingebettetsein in die Welt selbst.<br />
„Es ist unmöglich, dass <strong>der</strong> Mensch nicht Teil <strong>der</strong><br />
Natur ist <strong>und</strong> dass er nur Verän<strong>der</strong>ungen erleiden<br />
kann, die <strong>aus</strong> seiner Natur allein begriffen werden<br />
können <strong>und</strong> <strong>der</strong>en adäquate Ursache er ist.“ (4p4)<br />
Damit ist nicht gesagt, dass Leiden immer schlecht<br />
ist. Das, was auf uns einströmt, kann unser Tätigkeitsvermögen<br />
vermin<strong>der</strong>n, aber auch erhöhen. Es<br />
kann unsere Fähigkeit zum Handeln erhöhen o<strong>der</strong><br />
vermin<strong>der</strong>n, ist aber vom Handeln stets zu unterscheiden.<br />
Da wir stets Teil <strong>der</strong> Natur sind, leiden<br />
wir immer, es kommt gewissermaßen auf die Quantität<br />
des Leidens an, was Spinoza in <strong>der</strong> Definition<br />
des Affekts auch klarstellt. Absolut <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Notwendigkeit<br />
<strong>der</strong> eigenen Natur zu handeln ist somit eine<br />
Grenzbestimmung, <strong>der</strong> wir uns nur mehr o<strong>der</strong> min<strong>der</strong><br />
annähern können. Ich wüsste gegen diesen Aspekt<br />
nun keinen Einwand, <strong>der</strong> sich <strong>aus</strong> <strong>der</strong><br />
Marxschen Perspektive ergeben könnte. Auch in<br />
einer freien Gesellschaft, so Marx, bleibt das Reich<br />
<strong>der</strong> Gezwungenheit bestehen, wenn auch qualitativ<br />
reduziert. Zweitens: Der Mangel an adäquaten<br />
Ideen hin<strong>der</strong>t uns ebenso am Handeln. Spinoza<br />
stellt diese Bestimmung an den Beginn des dritten<br />
Teiles seiner <strong>Ethik</strong>, ich zitiere: „Hier<strong>aus</strong> folgt, dass<br />
<strong>der</strong> Geist um so mehr dem Leiden unterworfen ist,<br />
je mehr inadäquate Ideen er hat, dass er dagegen<br />
um so mehr handelt, je mehr adäquate Ideen er<br />
hat.“ (3p2c) Das führt uns zum diffizilen <strong>und</strong> komplexen<br />
Problem, wie <strong>der</strong> Geist seine inadäquaten<br />
Ideen minimieren <strong>und</strong> in adäquate Ideen weiterführen<br />
kann. Die Frage, was uns am Handeln hin<strong>der</strong>t,<br />
ist somit auch mit <strong>der</strong> Frage verknüpft, was uns<br />
daran hin<strong>der</strong>t, adäquate Iden zu bilden? Auch beim<br />
Geist ist zwischen Tätigkeitsvermögen <strong>und</strong> Freiheit<br />
zu unterscheiden. Das Tätigkeitsvermögen des<br />
Geistes entspricht <strong>der</strong> Quantität seines Auffassungso<strong>der</strong><br />
Erfassungsvermögens. Wenn Spinoza postuliert:<br />
„Der menschliche Geist ist befähigt, vieles zu<br />
erfassen <strong>und</strong> umso befähigter, auf je mehr Weisen<br />
sein Körper disponiert werden kann“ (2p14), so<br />
meint „vieles erfassen“ keineswegs vieles auch adäquat<br />
zu erfassen. Das Tätigkeitsvermögen des Körpers<br />
korrespondiert mit dem Tätigkeitsvermögen<br />
des Geistes. „Alles, was das Tätigkeitsvermögen unseres<br />
Körpers vermehrt o<strong>der</strong> vermin<strong>der</strong>t, för<strong>der</strong>t<br />
o<strong>der</strong> hemmt, dessen Idee vermehrt o<strong>der</strong> vermin<strong>der</strong>t,<br />
för<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> hemmt das Denkvermögen unseres<br />
Geistes.“ (3p11) Spinoza spricht hier explizit<br />
nicht von adäquaten Ideen, son<strong>der</strong>n eben vom<br />
Denkvermögen, cogitandi potentiam, unseres Intellekts.<br />
Einen Faktor, <strong>der</strong> das quantitative Verhältnis zwischen<br />
den inadäquaten zugunsten <strong>der</strong> adäquaten<br />
Ideen verschieben könnte, meine ich in <strong>Spinozas</strong><br />
Lehrsätzen über die Allseitigkeit des Affizieren <strong>und</strong><br />
Affiziertwerden gef<strong>und</strong>en zu haben. „Das, was den<br />
menschlichen Körper so disponiert, dass er auf viele<br />
Weisen affiziert werden kann, o<strong>der</strong> was ihn fähig<br />
macht, äußere Körper auf viele Weisen zu affizieren,<br />
ist dem Menschen nützlich <strong>und</strong> um so nützlicher, je<br />
fähiger <strong>der</strong> Körper dadurch gemacht wird, auf viele<br />
Weisen affiziert zu werden <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Körper zu<br />
affizieren.“ (4p38) Und Spinoza setzt hinzu: „Je<br />
mehr <strong>der</strong> Körper hierzu fähig gemacht wird, desto<br />
fähiger wird <strong>der</strong> Geist zum Erkennen gemacht.“<br />
(4p38dem) Einseitigkeit, auch wenn sie Lust zur<br />
Folge hat, wird von Spinoza als einschränkend <strong>und</strong><br />
daher negativ bezeichnet. Wenn die Begierde, so<br />
Spinoza, keine Rücksicht auf den ganzen Menschen<br />
nimmt, dann kann auch Lust ein Übermaß haben.<br />
Auch bei diesem Thema finden wir Berührungspunkte<br />
mit Marx. Reduktion, Einschränkung, Fixierung<br />
auf bestimmte Lebensvollzüge ist für Marx<br />
stets negativ. Umgekehrt hält Marx Allseitigkeit<br />
<strong>und</strong> wahren Reichtum für Bedingungen wie für Resultat<br />
von Freiheit: So lesen wir in den Gr<strong>und</strong>rissen<br />
einer Vorarbeit zum Kapital: „In fact aber, wenn die<br />
13