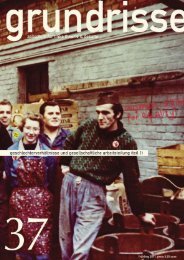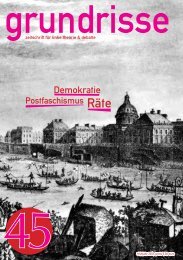Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Bedeutung und Defizite der Ethik Spinozas aus Marxistischer Sicht ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Karl Reitter | Marx & Spinoza<br />
auch sehr klar, was <strong>der</strong> Geist erkennen muss, wenn<br />
er tatsächlich erkennt, wenn er tatsächlich handelt.<br />
Es ist das nicht knappe Gut Gott. „Das höchste<br />
Gut des Geistes ist die Erkenntnis Gottes, <strong>und</strong> die<br />
höchste Tugend des Geistes ist es, Gott zu erkennen.“<br />
(4p28) Nur zur Klarstellung: Der Gott <strong>Spinozas</strong><br />
hat mit dem theologischen Gott <strong>der</strong> Religionen<br />
nichts gemein. Wer Gott erkennt, erkennt die<br />
Welt. O<strong>der</strong>, wie es Spinoza im 5. Teil <strong>aus</strong>spricht: „Je<br />
mehr wir die Einzeldinge erkennen, umso mehr erkennen<br />
wir Gott.“ (5p24) Wenn Spinoza nun<br />
davon spricht, dass allen, die den Weg <strong>der</strong> Tugend<br />
gehen <strong>und</strong> somit wahrhaft handeln, das höchste<br />
Gut gemeinsam ist <strong>und</strong> es als nicht knappes Gut<br />
keine Besitzansprüche, keinen Neid <strong>und</strong> keine Eifersucht<br />
bewirken kann, so ist diese Aussage mit<br />
Marx kompatibel. Auch bei Marx muss eine freie<br />
Gesellschaft auf nicht knappen Gütern beruhen,<br />
<strong>und</strong> dieses nicht knappe Gut ist die Vergesellschaftung<br />
selbst.<br />
Die freie Gesellschaft, die auf freien Individuen beruht,<br />
ist eine Gesellschaft von Menschen, die begreifen,<br />
dass das Wichtigste für ihre Freiheit die<br />
Freiheit <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en ist, die versuchen, sich in Liebe<br />
zu verbinden, wobei die Liebe zum Sein, welches,<br />
identifiziert mit dem eigentümlichen Gottesbegriff<br />
bei Spinoza durch inneres Leuchen erstrahlt, ihre<br />
gegenseitige Liebe <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaft stabilisiert. Es<br />
fehlt jedoch völlig die Einbeziehung <strong>der</strong> materiellen<br />
wie geistigen Produktion <strong>und</strong> Reproduktion <strong>der</strong><br />
Gesellschaft, <strong>und</strong> zwar sowohl hinsichtlich <strong>der</strong> geltenden<br />
gesellschaftlichen Formen als auch hinsichtlich<br />
möglicher zu antizipieren<strong>der</strong> Momente einer<br />
freien Gesellschaft. Inwiefern uns das Kapitalverhältnis<br />
am tatsächlichen Handeln hin<strong>der</strong>t <strong>und</strong> welche<br />
Formen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Arbeit<br />
überw<strong>und</strong>en werden müssen, um Handeln zu ermöglichen,<br />
kann Spinoza nicht thematisieren. Dass<br />
die gesamte Dimension des Kapitalverhältnisses bei<br />
Spinoza fehlt, dafür ist er nicht zu rügen. Nach<br />
meiner Auffassung konnte selbst von Frühkapitalismus<br />
in den Vereinigten Provinzen zu Lebenszeit<br />
Zitierte Literatur / Siglen:<br />
<strong>Spinozas</strong> keine Rede sein. Er konnte die <strong>Bedeutung</strong><br />
des Klassenverhältnisses nicht erkennen, weil es<br />
nichts zu erkennen gab. Aber wir können es. Wenn<br />
Spinoza in seiner Definition <strong>der</strong> Gezwungenheit<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Freiheit davon spricht, dass ein an<strong>der</strong>s<br />
Ding jemanden zwingt „auf gewisse <strong>und</strong> bestimmte<br />
Weise zu existieren“ (nämlich in <strong>der</strong> proletarischen<br />
Existenzsituation zu verharren) „<strong>und</strong> zu wirken“, so<br />
formuliert unser Philosoph auf höchster Abstraktionsstufe<br />
die Bedingungen für Unfreiheit <strong>und</strong> umgekehrt<br />
ebenso die Bedingungen <strong>der</strong> Freiheit. Dass<br />
Spinoza die Dynamik <strong>der</strong> Unfreiheit, wenn ich nun<br />
das Kapitalverhältnis so bezeichnen darf, nicht erkennen<br />
konnte, ist ein Mangel, den wir in <strong>der</strong> Rezeption,<br />
so wir dem Denken <strong>Spinozas</strong> Aktualität<br />
verleihen wollen, zu berücksichtigen haben.<br />
Wir können jedoch durch<strong>aus</strong> im Sinne <strong>Spinozas</strong><br />
den ersten Lehrsatz des vierten Teils auf ihn selbst<br />
anwenden. „Nichts von dem, was eine falsche Idee<br />
Positives enthält, wird durch die Gegenwart des<br />
Wahren, insofern es wahr ist, aufgehoben.“ (4p1)<br />
Setzen wir für die falsche Idee die <strong>Ethik</strong> <strong>Spinozas</strong><br />
ein. Sie ist mangelhaft, da sie den Prozess <strong>der</strong> entfremdeten<br />
Arbeit nicht erfassen kann, aber sie enthält<br />
Positives. Sie thematisiert auf sehr abstrakter<br />
Ebene das Wechselspiel zwischen Tätigkeitsvermögen<br />
<strong>und</strong> Freiheit, somit jene zwei Achsen, die jede<br />
Theorie <strong>der</strong> Befreiung nach meiner Auffassung beinhalten<br />
muss. Reduzieren wir alles auf das Tätigkeitsvermögen,<br />
so kreieren wir eine eindimensionale<br />
Welt des Ja o<strong>der</strong> Nein zu dieser Produktivität. Lassen<br />
wir diese Dimension fallen <strong>und</strong> fokussieren wir<br />
auf geistige Erkenntnis, so entmaterialisiert sich<br />
Freiheit <strong>und</strong> Vernunft. Das Wechselspiel dieser Dimensionen<br />
gezeigt zu haben, ist ein wesentlicher<br />
Aspekt des Positiven <strong>der</strong> <strong>Ethik</strong> <strong>Spinozas</strong>. Akzeptieren<br />
wir die Marxsche Theorie als Gegenwart des<br />
Wahren, so hebt nun dieses Wahre, insbeson<strong>der</strong>e<br />
die Figur <strong>der</strong> entfremdeten Arbeit, die Erkenntnisse<br />
<strong>Spinozas</strong> keineswegs auf.<br />
E-Mail: k.reitter@gmx.net<br />
15<br />
Marx, Karl, (MEW 19) „Kritik des Gothaer Programms“, Seite 13-32<br />
Marx, Karl, (MEW 23) „Das Kapital, Band 1“<br />
Marx, Karl, (MEW 42) „Gr<strong>und</strong>risse <strong>der</strong> Kritik <strong>der</strong> politischen Ökonomie“<br />
Spinoza, Baruch, (1997) „Die <strong>Ethik</strong>“, lateinisch <strong>und</strong> deutsch, revidierte Übersetzung von Jakob Stern, Stuttgart<br />
Zitierprinzip <strong>der</strong> <strong>Ethik</strong> <strong>Spinozas</strong>: Die Teile <strong>der</strong> <strong>Ethik</strong> werden mit arabischen Ziffer angegeben, <strong>der</strong> darauf folgende Kleinbuchstabe<br />
bestimmt die Satzart (z.B. p = propositio, Lehrsatz), danach die Nummer plus eventuell weitere Spezifikation nach demselben<br />
Prinzip. 4p37s2 bedeutet also 4. Buch, 37. Lehrsatz, Anmerkung<br />
a = axioma, Axiom<br />
app = appendix, Anhang<br />
c = collarium, Zusatz<br />
cap = caput, Hauptsatz<br />
d = definitio, Definition<br />
dem = demonstratio, Beweis<br />
lem = lemma, Hilfssatz<br />
p = propositio, Lehrsatz<br />
post = postulatum, Postulat<br />
praef = praefatio, Vorwort<br />
s = scholium, Anhang<br />
exp = explicatio, Erläuterung