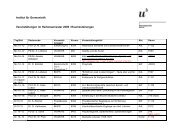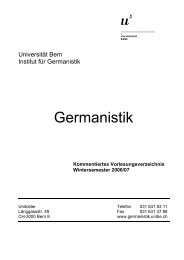Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Begriff der Arbeit: Anthropologische Grundlagen und literarische<br />
Entwürfe einer kulturellen Praxis vom 19. Jahrhundert bis zur „dritten<br />
industriellen Revolution“<br />
Zeit: Mittwoch, 14-16<br />
Dauer: 30.10.20<strong>02</strong>-05.<strong>02</strong>.20<strong>03</strong><br />
ECTS-Punkte: 6<br />
„Die mit der Ausbildung der Hand, mit der Arbeit, beginnende Herrschaft über die Natur erweiterte bei jedem neuen Fortschritt<br />
den Gesichtskreis des Menschen. An den Naturgegenständen entdeckte er fortwährend neue, bisher unbekannte Eigenschaften.<br />
Andrerseits trug die Ausbildung der Arbeit notwendig dazu bei, die Gesellschaftsglieder näher aneinanderzuschließen,<br />
indem sie die Fälle gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamen Zusammenwirkens vermehrte [...]. Kurz, die werdenden<br />
Menschen kamen dahin, daß sie einander etwas zu sagen hatten. Das Bedürfnis schuf sich ein Organ: Der unentwickelte<br />
Kehlkopf des Affen bildete sich langsam aber sicher um, durch Modulation <strong>für</strong> stets gesteigerte Modulation, und<br />
die Organe des Mundes lernten allmählich einen artikulierten Buchstaben nach dem andern aussprechen.“<br />
Anhand dieser Einsichten über die funktionelle Evolution des lautlichen Symbols auf Grund des aufrechten<br />
Ganges, der die Lösung der vorderen Extremitäten vom Boden, die allmähliche Verlagerung<br />
der Aufgaben von Hand und Gebiß in das Werkzeug und ihre kollektive Organisation in den Formen<br />
der Arbeit ermöglicht, skizzierte Friedrich Engels im Jahr 1876 die Grundlagen einer im Schnittpunkt<br />
von Naturwissenschaft, politischer Ökonomie, Technikgeschichte und Sprachwissenschaft angesiedelten<br />
Soziallehre. Nicht mehr als „Subjekt-“ oder „Bewußtseinsphilosophie“ konzipiert, wiesen ihre gemeinsam<br />
mit Marx erarbeiteten Umrisse zurück auf die naturalistische Anthropologie Herders und zugleich<br />
voraus auf moderne Verständnisse des Menschen als eines sozial tätigen Wesens. Dort erhält der<br />
Begriff der Arbeit seine folgenreiche Bedeutung: Das Einzelsubjekt orientiert sich weder an einem Dasein<br />
von ursprünglicher Naturhaftigkeit (Rousseau: Émile) noch trägt es seine Bildungsinteressen<br />
gleichsam von außen an die Gesellschaft heran (Goethe: Wilhelm Meister), sondern seine Befindlichkeiten<br />
sind längst, merklich oder unmerklich, von den Auffassungen der arbeitenden Sozialwelt geprägt.<br />
Während sich dieser Nachweis der Ideologiehaltigkeit einerseits theoretisch unglücklich mit der<br />
Idee des „Klassenkampfs“ verbindet, vermag andererseits die „Verweltlichung der Kultur“, die totale<br />
„Autonomie der Individuen und der Sachgebiete“ nüchtern festgestellt zu werden. Ins Zentrum der<br />
„verstehenden Soziologie“ Max Webers rückt das arbeitsteilig spezialisierte Handeln in Kombination<br />
mit der Frage nach dem subjektiven „Sinn“. Der „Berufsmensch“ strebt nach Verfügungsgewalt über<br />
den Nutzen seiner Tätigkeit; weil deren Zweck jedoch stets ein „sachlicher“ bleibt, verspürt er zugleich<br />
ihren Automatismus, der ihn von jeder normativ aufgeladenen persönlichen Beziehung und zuletzt von<br />
der Arbeit selbst entfremdet. Dieses Szenarium gestalten literarische Autoren als ethisches Spannungsgefüge<br />
zwischen Zweck und Mittel sowie zwischen humaner Disposition und praktischer Rationalität<br />
in unterschiedlichen, auch dokumentarischen Formen, weil sie dabei auch eine Arbeitsfolgen lediglich<br />
„zerstreuende“ Kulturindustrie kritisch zu reflektieren beginnen. Gelesen werden voraussichtlich folgende<br />
dichterische Werke: Georg Weerth: Fragment eines Romans [entst. 1843-47]. – Else Lasker-<br />
Schüler: Die Wupper [1909]. – Hermann Broch: Die Entsühnung [entst. 1932]. – Max von der Grün:<br />
Irrlicht und Feuer [1963].<br />
Literaturangaben:<br />
• Friedrich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen [entst. 1876]. In: Dialektik der Natur. Karl<br />
Marx/Friedrich Engels: Werke. Berlin (Ost) 1962, S.444-455.<br />
• André Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst [1964/65]. Übers. v. Michael<br />
Bischoff. Frankfurt/M. 1980.<br />
• Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Bd.3. Erfahrungswissenschaften und Technik.<br />
Bd.4. Die religiösen Kräfte. Freiburg i. Br. 1934/37 (Nachdruck München 1987).<br />
• Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss einer verstehenden Soziologie [1922]. 5., rev. Aufl. bes. v. Johannes<br />
Winckelmann. Tübingen 1980.<br />
• Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt/M. 1994.<br />
• Günter Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution.<br />
Bd.2. Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution [1956/1980]. München<br />
1994/95.<br />
18