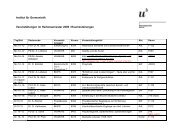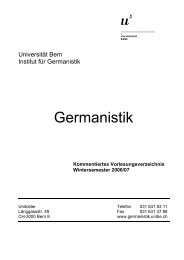Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 02/03 - Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
22<br />
Die Kunst, Geschichten unterhaltsam und spannend zu erzählen, steht heutzutage im Wettstreit mit<br />
der effektvollen Anordnung von Bildern und ihrer Unterlegung mit Klängen und Sprache. Die<br />
Medienkonkurrenz provoziert aber gerade dazu, nach den Kriterien zu fragen, nach denen Geschichten<br />
gut erzählt sind. Sind diese Kriterien überzeitlich gültig? Oder haben sich die Anforderungen an gut<br />
erzählte Geschichten seit der Goethezeit gewandelt? Es gibt keine allgemeine Theorie der Novelle,<br />
sondern die Konjunktur dieser Erzählgattung war seit Boccaccios „Decamerone“ stets mit der Kritik an<br />
gängigen Literaturformen und der Forderung nach Ausweitung des Lesepublikums verbunden.<br />
Die Geschichte der deutschsprachigen Novellistik, die mit Gottfried Kellers und C.F. Meyers Erzählungen<br />
klassisches Format erreicht, beginnt mit Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ .<br />
Die Rahmenerzählung nimmt Bezug auf das „Decamerone“ Boccaccios, des erklärten Lieblings eines<br />
nach Unterhaltung begierigen weiblichen Publikums. Die zur Ablenkung von den politischen Wirren<br />
der 1790er Jahre vorgetragenen Gespenstergeschichten, moralischen Erzählungen und das Schlußmärchen<br />
verarbeiten mehr oder weniger gelungen die aktuellen gesellschaftlichen Krisenerfahrungen und<br />
werden in der Erzählrunde strenger, kontroverser poetologischer Kritik unterworfen. Nach der intertextuellen<br />
Analyse der „Unterhaltungen“, die literaturgeschichtlich immanent verfährt, wollen wir die<br />
Kontexte erforschen, besonders die Revolutionspublizistik in den historischen und literarischen Zeitschriften<br />
und kritische Besprechungen der „Unterhaltungen“.<br />
Literaturangaben:<br />
• Goethes „Unterhaltungen“ in einer beliebigen Ausgabe und die Kommentare in der „Frankfurter Ausgabe“ und der<br />
„Münchener Ausgabe“ von Goethes Werken.<br />
• Hannelore Schlaffer: Poetik der Novelle. Stuttgart 1993.<br />
• Artikel „Novelle“ von Hugo Aust in Killys Literaturlexikon, Bd. 14, München 1993, S. 170-175.<br />
• Artikel „Novelle“ von Horst Thomé und Winfried Wehle in Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 2,<br />
hg. von Harald Fricke. Berlin 2000, S. 725-731.<br />
Hauptseminar: Prof. Dr. Yahya Elsaghe/ Assistenz: Franka Marquardt<br />
Thomas Mann, Buddenbrooks<br />
Zeit: Mittwoch 18-20<br />
Dauer: 30.10.20<strong>02</strong>-05.<strong>02</strong>.20<strong>03</strong><br />
ECTS-Punkte: 7<br />
Aus Anlass seiner neuen Herausgabe und Kommentierung im Rahmen der ‚Grossen kommentierten<br />
Frankfurter Ausgabe‘ soll Thomas Manns erster Roman einer kritischen Relektüre unterzogen werden.<br />
Folgende Fragestellungen sind da<strong>für</strong> vorgesehen:<br />
• Thomas Manns Selbstkommentare<br />
• Autobiographische Beziehungen<br />
• Der „Verfall einer Familie“ im Verhältnis zur Geschichte und Vorgeschichte des ‚Zweiten‘ Deutschen Reichs<br />
• Antisemitische Stereotype<br />
• Lübeck in „Buddenbrooks“, Thomas Mann in Lübeck<br />
• Innerdeutsche Stereotypisierungen (zum Beispiel München und Bayern)<br />
• Grenzüberschreitungen (Frankreich, Litauen, Südamerika etc.)