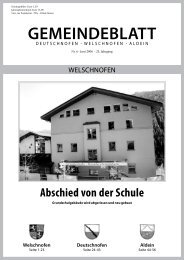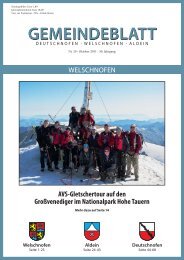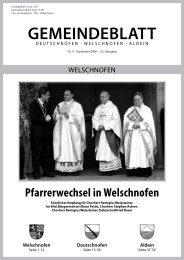Gemeindeblatt Nr. 10 / 2009 (2,45 MB)
Gemeindeblatt Nr. 10 / 2009 (2,45 MB)
Gemeindeblatt Nr. 10 / 2009 (2,45 MB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
welschnofen – <strong>10</strong>/<strong>2009</strong><br />
Die Gemeindeverwaltung<br />
Welschnofen trägt sich mit<br />
dem Gedanken, die „Romstraße“<br />
umzubenennen, wobei die<br />
Nummerierung gleich<br />
bleiben soll.<br />
Zur Geschichte der Liechtensteiner<br />
Die Bezeichnung „Romstraße“ wurde<br />
während der Zeit des Faschismus<br />
in Welschnofen eingeführt. Es ist also<br />
eine Namensgebung, die nicht durch<br />
die örtliche Verwaltung in Form eines<br />
demokratischen Aktes erfolgte, sondern<br />
durch die Willkür des damaligen<br />
Regimes. Jeglicher Bezug zu unserem<br />
Dorf fehlt. Eine Umbenennung ist also<br />
schon längst überfällig und wurde des<br />
Öfteren von verschiedener Seite angemahnt.<br />
Das heurige Gedenkjahr wäre<br />
ein willkommener Anlass, das Vorhaben<br />
endlich umzusetzen.<br />
Viele Straßen in Welschnofen und Karersee<br />
sind nach unseren Bergen, nach<br />
Forschern, Pionieren oder berühmten<br />
Gästen benannt. Es liegt nahe, bei der<br />
Benennung der Hauptstraße, die durch<br />
unser Dorfzentrum führt und über die<br />
man ursprünglich zum Schloss Karneid<br />
gelangte, einen historischen Bezug herzustellen.<br />
Welschnofen unterstand lange Zeit<br />
der Gerichtsbarkeit Karneid, welche fast<br />
400 Jahre (1387–1766) von den Herren<br />
von Liechtenstein auf der Burg Karneid<br />
ausgeübt wurde. Das Gericht war zuständig<br />
für die gesamte politische Verwaltung<br />
und für die Rechtspflege, für<br />
die Einhebung von Steuern, für die<br />
Landesverteidigung, für die öffentliche<br />
Sicherheit sowie für die Instandhaltung<br />
der Verkehrswege, die Armenpflege<br />
und die Nutzung der Wald- und<br />
Weiderechte.<br />
In dieser langen Zeit war das Verhältnis<br />
zwischen den Liechtensteinern als<br />
Gerichtsherren und den Welschnofner<br />
Untertanen mitunter auch schwierig.<br />
Diese Epoche aber betrifft die wechselvolle<br />
Geschichte unserer Vorfahren, an<br />
die durch die neue Namensgebung erinnert<br />
werden soll.<br />
Auch unsere Nachbargemeinde<br />
Karneid, zu der das „Viertel<br />
Welschnofen“ bis 1870 gehörte, hat<br />
heute noch einen Bezug zu diesem geschichtlichen<br />
Abschnitt. Sie führt das<br />
Wappen der Liechtensteiner als Gemeindewappen.<br />
Zur Geschichte der<br />
Herren von Liechtenstein<br />
Die Herren von Liechtenstein, welche<br />
ihren Aufstieg als Ministerialen der<br />
Bischöfe von Trient begannen, waren<br />
ein sehr angesehenes Geschlecht. Ihre<br />
Stammburg dürfte bei Leifers gelegen<br />
sein; eine schweizerische Herkunft<br />
dieser Adelsfamilie wird ebenfalls vermutet.<br />
Heinrich von Liechtenstein bekleidete<br />
im Bistum Trient mehrere hohe<br />
Ämter und erwarb 1387 zur Gänze<br />
die Herrschaft Karneid, dem neben<br />
Steinegg und Gummer auch das Viertel<br />
Welschnofen angehörte. Die Söhne<br />
Heinrichs, Hans und Wilhelm, begründeten<br />
zwei Linien.<br />
Der Enkel von Hans von Liechtenstein,<br />
Paul I., ein Liebling Kaiser Maximilians<br />
I., wurde in den Freiherrenstand<br />
gehoben. Pauls Sohn, Christoph<br />
Philipp I., erhielt 1530 den Grafentitel<br />
verliehen.<br />
Die Nachkommen Wilhelms von<br />
Liechtenstein saßen bis zum Tode des<br />
letzten Stammhalters im Jahr 1625 auf<br />
Karneid. Nach dem Ende dieser ritterlichen<br />
Linie ging das Lehen Karneid<br />
zur Gänze an die gräfliche Familie der<br />
Liechtensteiner (Philipp Rudolf von<br />
Liechtenstein) über.<br />
Nach dem Dreißigjährigen Krieg, im<br />
Jahr 1649, erlangten die Grafen von<br />
Liechtenstein die Untertanenherrschaft<br />
in Böhmen und Mähren. Ihr Einfluss<br />
und ihre wirtschaftliche Macht wuchsen<br />
im Laufe der Zeit, was sich auch<br />
an den zahlreichen Titeln des letzten<br />
Liechtensteiners, Franz Anton, zeigte:<br />
„Freiherr von Castelcorno und Isera,<br />
Herr von Schenna, Carneith, Tschengelsburg,<br />
Crumbach, Rungelstein,<br />
Telsch, Strabing, Rudein, Königsegg,<br />
Zellataw, Neu Meserizcko, Krassonitz<br />
und Borowa, Erbmarschall von Elsass,<br />
Ritter des Ordens vom hl. Wenzeslaus,<br />
Kämmerer der goldenen Schlüssel<br />
und wirklicher geheimer Rat bei Majestät“.<br />
Sowohl Graf Franz Anton als auch<br />
sein Vetter Thomas Joseph von Liechtenstein<br />
verstarben ohne männliche Erben,<br />
weshalb auch das Lehen „Karneid“<br />
im Jahr 1766 an die Stadt Bozen ging.<br />
Die Nachkommen der Liechtensteiner<br />
leben heute in Eferding in Oberösterreich.<br />
Der Name hat sich im Doppelnamen<br />
Podstatzky-Liechtenstein<br />
erhalten, nachdem die Schwester des<br />
Thomas Joseph den Grafen Podstatzky-<br />
Prussinowitz geheiratet hatte.<br />
Die Grafen Podstatzky zählten zu den<br />
ältesten Familien Mährens und waren<br />
seit 1630 ein freiherrliches und seit<br />
1714 ein gräfliches Geschlecht in Böhmen,<br />
Mähren und Schlesien. Ihr Name<br />
kommt von der 1408 erworbenen Besitzung<br />
Podstata (Bodenstadt).<br />
Quelle: Eduard Pichler: Welschnofen.<br />
Von der alten Zeit, Band III, Herrschaft<br />
und Untertan. Gerichtsherrschaft<br />
Karneid und Gemeinde Welschnofen<br />
im Wandel der Zeiten, Bozen – Wien<br />
2003<br />
Für Fragen, Anregungen und Vorschläge<br />
jeglicher Art steht die Gemeindeverwaltung<br />
gerne zur Verfügung.<br />
E-Mail-Adresse:<br />
elmar.pattis@welschnofen.eu<br />
Tel: 348 82 61 981<br />
Elmar Pattis, Franz Kohler<br />
4