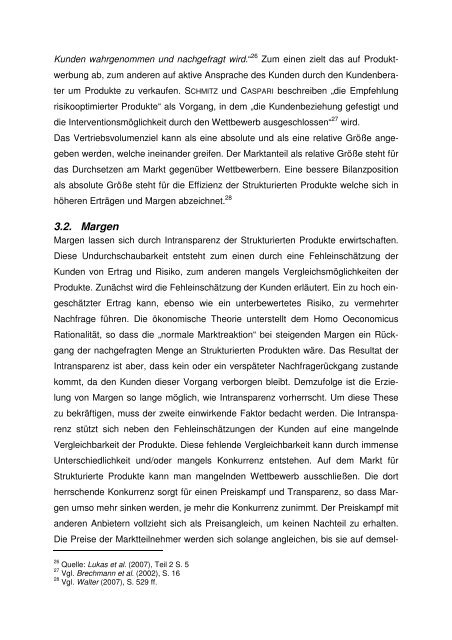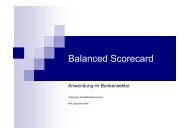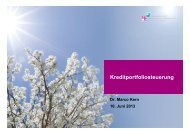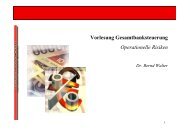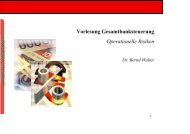Strukturierte Produkte im Kontext der Gesamtbanksteuerung
Strukturierte Produkte im Kontext der Gesamtbanksteuerung
Strukturierte Produkte im Kontext der Gesamtbanksteuerung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kunden wahrgenommen und nachgefragt wird.“ 26 Zum einen zielt das auf Produktwerbung<br />
ab, zum an<strong>der</strong>en auf aktive Ansprache des Kunden durch den Kundenberater<br />
um <strong>Produkte</strong> zu verkaufen. SCHMITZ und CASPARI beschreiben „die Empfehlung<br />
risikoopt<strong>im</strong>ierter <strong>Produkte</strong>“ als Vorgang, in dem „die Kundenbeziehung gefestigt und<br />
die Interventionsmöglichkeit durch den Wettbewerb ausgeschlossen“ 27 wird.<br />
Das Vertriebsvolumenziel kann als eine absolute und als eine relative Größe angegeben<br />
werden, welche ineinan<strong>der</strong> greifen. Der Marktanteil als relative Größe steht für<br />
das Durchsetzen am Markt gegenüber Wettbewerbern. Eine bessere Bilanzposition<br />
als absolute Größe steht für die Effizienz <strong>der</strong> <strong>Strukturierte</strong>n <strong>Produkte</strong> welche sich in<br />
höheren Erträgen und Margen abzeichnet. 28<br />
3.2. Margen<br />
Margen lassen sich durch Intransparenz <strong>der</strong> <strong>Strukturierte</strong>n <strong>Produkte</strong> erwirtschaften.<br />
Diese Undurchschaubarkeit entsteht zum einen durch eine Fehleinschätzung <strong>der</strong><br />
Kunden von Ertrag und Risiko, zum an<strong>der</strong>en mangels Vergleichsmöglichkeiten <strong>der</strong><br />
<strong>Produkte</strong>. Zunächst wird die Fehleinschätzung <strong>der</strong> Kunden erläutert. Ein zu hoch eingeschätzter<br />
Ertrag kann, ebenso wie ein unterbewertetes Risiko, zu vermehrter<br />
Nachfrage führen. Die ökonomische Theorie unterstellt dem Homo Oeconomicus<br />
Rationalität, so dass die „normale Marktreaktion“ bei steigenden Margen ein Rückgang<br />
<strong>der</strong> nachgefragten Menge an <strong>Strukturierte</strong>n <strong>Produkte</strong>n wäre. Das Resultat <strong>der</strong><br />
Intransparenz ist aber, dass kein o<strong>der</strong> ein verspäteter Nachfragerückgang zustande<br />
kommt, da den Kunden dieser Vorgang verborgen bleibt. Demzufolge ist die Erzielung<br />
von Margen so lange möglich, wie Intransparenz vorherrscht. Um diese These<br />
zu bekräftigen, muss <strong>der</strong> zweite einwirkende Faktor bedacht werden. Die Intransparenz<br />
stützt sich neben den Fehleinschätzungen <strong>der</strong> Kunden auf eine mangelnde<br />
Vergleichbarkeit <strong>der</strong> <strong>Produkte</strong>. Diese fehlende Vergleichbarkeit kann durch <strong>im</strong>mense<br />
Unterschiedlichkeit und/o<strong>der</strong> mangels Konkurrenz entstehen. Auf dem Markt für<br />
<strong>Strukturierte</strong> <strong>Produkte</strong> kann man mangelnden Wettbewerb ausschließen. Die dort<br />
herrschende Konkurrenz sorgt für einen Preiskampf und Transparenz, so dass Margen<br />
umso mehr sinken werden, je mehr die Konkurrenz zun<strong>im</strong>mt. Der Preiskampf mit<br />
an<strong>der</strong>en Anbietern vollzieht sich als Preisangleich, um keinen Nachteil zu erhalten.<br />
Die Preise <strong>der</strong> Marktteilnehmer werden sich solange angleichen, bis sie auf demsel-<br />
26 Quelle: Lukas et al. (2007), Teil 2 S. 5<br />
27 Vgl. Brechmann et al. (2002), S. 16<br />
28 Vgl. Walter (2007), S. 529 ff.