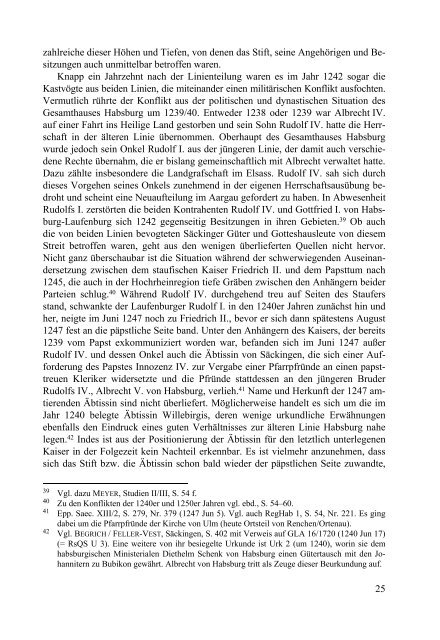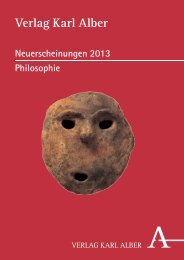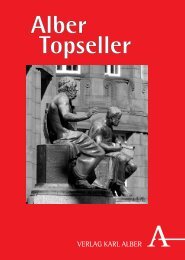Unter dem Wappen der Fidel - Verlag Karl Alber
Unter dem Wappen der Fidel - Verlag Karl Alber
Unter dem Wappen der Fidel - Verlag Karl Alber
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zahlreiche dieser Höhen und Tiefen, von denen das Stift, seine Angehörigen und Besitzungen<br />
auch unmittelbar betroffen waren.<br />
Knapp ein Jahrzehnt nach <strong>der</strong> Linienteilung waren es im Jahr 1242 sogar die<br />
Kastvögte aus beiden Linien, die miteinan<strong>der</strong> einen militärischen Konflikt ausfochten.<br />
Vermutlich rührte <strong>der</strong> Konflikt aus <strong>der</strong> politischen und dynastischen Situation des<br />
Gesamthauses Habsburg um 1239/40. Entwe<strong>der</strong> 1238 o<strong>der</strong> 1239 war Albrecht IV.<br />
auf einer Fahrt ins Heilige Land gestorben und sein Sohn Rudolf IV. hatte die Herrschaft<br />
in <strong>der</strong> älteren Linie übernommen. Oberhaupt des Gesamthauses Habsburg<br />
wurde jedoch sein Onkel Rudolf I. aus <strong>der</strong> jüngeren Linie, <strong>der</strong> damit auch verschiedene<br />
Rechte übernahm, die er bislang gemeinschaftlich mit Albrecht verwaltet hatte.<br />
Dazu zählte insbeson<strong>der</strong>e die Landgrafschaft im Elsass. Rudolf IV. sah sich durch<br />
dieses Vorgehen seines Onkels zunehmend in <strong>der</strong> eigenen Herrschaftsausübung bedroht<br />
und scheint eine Neuaufteilung im Aargau gefor<strong>der</strong>t zu haben. In Abwesenheit<br />
Rudolfs I. zerstörten die beiden Kontrahenten Rudolf IV. und Gottfried I. von Habsburg-Laufenburg<br />
sich 1242 gegenseitig Besitzungen in ihren Gebieten. 39 Ob auch<br />
die von beiden Linien bevogteten Säckinger Güter und Gotteshausleute von diesem<br />
Streit betroffen waren, geht aus den wenigen überlieferten Quellen nicht hervor.<br />
Nicht ganz überschaubar ist die Situation während <strong>der</strong> schwerwiegenden Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
zwischen <strong>dem</strong> staufischen Kaiser Friedrich II. und <strong>dem</strong> Papsttum nach<br />
1245, die auch in <strong>der</strong> Hochrheinregion tiefe Gräben zwischen den Anhängern bei<strong>der</strong><br />
Parteien schlug. 40 Während Rudolf IV. durchgehend treu auf Seiten des Staufers<br />
stand, schwankte <strong>der</strong> Laufenburger Rudolf I. in den 1240er Jahren zunächst hin und<br />
her, neigte im Juni 1247 noch zu Friedrich II., bevor er sich dann spätestens August<br />
1247 fest an die päpstliche Seite band. <strong>Unter</strong> den Anhängern des Kaisers, <strong>der</strong> bereits<br />
1239 vom Papst exkommuniziert worden war, befanden sich im Juni 1247 außer<br />
Rudolf IV. und dessen Onkel auch die Äbtissin von Säckingen, die sich einer Auffor<strong>der</strong>ung<br />
des Papstes Innozenz IV. zur Vergabe einer Pfarrpfründe an einen papsttreuen<br />
Kleriker wi<strong>der</strong>setzte und die Pfründe stattdessen an den jüngeren Bru<strong>der</strong><br />
Rudolfs IV., Albrecht V. von Habsburg, verlieh. 41 Name und Herkunft <strong>der</strong> 1247 amtierenden<br />
Äbtissin sind nicht überliefert. Möglicherweise handelt es sich um die im<br />
Jahr 1240 belegte Äbtissin Willebirgis, <strong>der</strong>en wenige urkundliche Erwähnungen<br />
ebenfalls den Eindruck eines guten Verhältnisses zur älteren Linie Habsburg nahe<br />
legen. 42 Indes ist aus <strong>der</strong> Positionierung <strong>der</strong> Äbtissin für den letztlich unterlegenen<br />
Kaiser in <strong>der</strong> Folgezeit kein Nachteil erkennbar. Es ist vielmehr anzunehmen, dass<br />
sich das Stift bzw. die Äbtissin schon bald wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> päpstlichen Seite zuwandte,<br />
39<br />
Vgl. dazu MEYER, Studien II/III, S. 54 f.<br />
40<br />
Zu den Konflikten <strong>der</strong> 1240er und 1250er Jahren vgl. ebd., S. 54–60.<br />
41<br />
Epp. Saec. XIII/2, S. 279, Nr. 379 (1247 Jun 5). Vgl. auch RegHab 1, S. 54, Nr. 221. Es ging<br />
dabei um die Pfarrpfründe <strong>der</strong> Kirche von Ulm (heute Ortsteil von Renchen/Ortenau).<br />
42<br />
Vgl. BEGRICH / FELLER-VEST, Säckingen, S. 402 mit Verweis auf GLA 16/1720 (1240 Jun 17)<br />
(= RsQS U 3). Eine weitere von ihr besiegelte Urkunde ist Urk 2 (um 1240), worin sie <strong>dem</strong><br />
habsburgischen Ministerialen Diethelm Schenk von Habsburg einen Gütertausch mit den Johannitern<br />
zu Bubikon gewährt. Albrecht von Habsburg tritt als Zeuge dieser Beurkundung auf.<br />
25