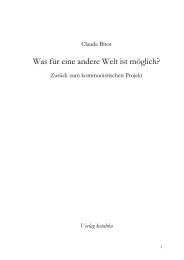Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bei ihrer Einschätzung der laufenden Vernichtung der Lebensformen<br />
verfallen die Biologen und Ökologen allerdings häufig einem<br />
quantitativen oder qualitativen Artenfetischismus. 7 Den quantitativen<br />
fasziniert vor allem die Vielzahl. Nichts natürlicher, als dass er deshalb<br />
sein Augenmerk auf die Tropen richtet; in Kolumbien gibt es 1525<br />
Brutvogelarten, im gemässigten Staate New York nur 195. Der<br />
qualitative Artenfetischismus interessiert sich für die Seltenheit der<br />
Arten, daher besonders für Inseln und isolierte Biome 8 mit nur lokal<br />
verbreiteten endemischen 9 Arten. Vor allem Lebensräume mit relativ<br />
stabilen, nicht extremen ökologischen Parametern, worunter jedoch mit<br />
karger Nährstoffversorgung, erweisen sich als ausserordentlich<br />
artenreich. 10 Als letzte Ökonische mit dieser Voraussetzung ist die<br />
Tiefsee entdeckt worden.<br />
<strong>Die</strong> beiden Formen von Artenfetischismus, die wir hier betrachten,<br />
stehen in engem Zusammenhang mit dem Wissenschaftsbetrieb und<br />
seinem expliziten oder uneingestandenen Ziel, dem<br />
Verwertungsbedürfnis des Kapitals zu dienen. Edward 0. Wilsons<br />
Verdienst um die Erhaltung der Biodiversität soll keineswegs<br />
geschmälert werden, doch scheint ihm der Selbstwert der Vielfalt und<br />
der einzelnen Lebensform zu entgehen. Sein Buch „Ende der<br />
biologischen Vielfalt?“ verteidigt die unermessliche Fülle von<br />
Lebensformen im Sinne eines zu erhaltenden Gen-Kapitals. Oder greift<br />
E. 0. Wilson aus rhetorischen Gründen beispielsweise zum Argument<br />
der in den (tropischen) Pflanzen und andern Organismen enthaltenen<br />
pharmazeutischen Wirkstoffe, um eine anthropozentrisch 11 gesinnte<br />
Menschheit zur' Saison zu bringen? Immerhin glaubt er an eine<br />
menschliche Biophilie (eine emphatische Form des<br />
Anthropozentrismus): eine, die mehr als touristisch-ästhetisch ist? Zu<br />
Recht schreibt David Ehrenfeld in „Ende der biologischen Vielfalt“ (S.<br />
239) "Mir drängt sich immer der Gedanke auf, dass zu einem Zeitpunkt,<br />
da wir es geschafft haben, der biologischen Vielfalt einen Wert<br />
zuzuschreiben, nicht mehr viel von dieser Vielfalt übrig sein wird."<br />
Es wird eifrig und hektisch inventarisiert und qualifiziert. Nach<br />
ausgeklügelten Kriterien, die dem Gesamtzusammennang der<br />
Lebensformen innerhalb einer mineralischen, physikalischen Natur<br />
gerecht werden sollen, werden Schutzgebiete ausgeschieden: die<br />
Florenprovinz Kalifornien, der kolumbianische Choco, die<br />
Elfenbeinküste, die Westghats in Indien usw. Es sind ‚heisse Stellen',<br />
die, neben vielen Pazifikinseln, seltene endemische Arten beherbergen.<br />
Was ist aber mit den riesigen, 'eintönigen' Wald-, Steppen-, Mangroven-<br />
, Wüsten- und Eisgebieten, deren Artenvielfalt und -einzigkeit oft wenig<br />
4