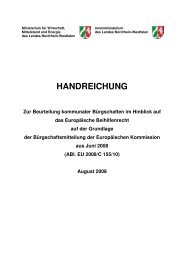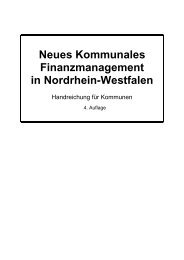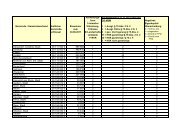Gutachten (PDF) - MIK NRW
Gutachten (PDF) - MIK NRW
Gutachten (PDF) - MIK NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen<br />
Normierung der Steuerkraft: Alle Flächenländer normieren die Steuerkraft der Realsteuern: Während<br />
manche Länder gesetzlich geregelte fiktive Hebesätze haben, so z.B. Bayern, Baden-Württemberg und<br />
Hessen, orientieren sich die fiktiven Hebesätze anderer Flächenländer am gewogenen Landesdurchschnitt<br />
i.d.R. des Vorjahres. Als Beispiel für die zweite Gruppe, welche den gewogenen Landesdurchschnitt<br />
der tatsächlichen Hebesätze bei den Realsteuern verwendet, dienen u.a. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Niedersachsen. Auch die Höhe der fiktiven Hebesätze unterscheidet sich stark. In<br />
Baden-Württemberg sind die fiktiven Hebesätze sehr niedrig mit 195% und 185% für die Grundsteuer A<br />
und B und 290% für die Gewerbesteuer – auch sind sie seit 1982 festgesetzt. Während Brandenburg<br />
100% des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorjahres abzüglich der Gewerbesteuerumlage ansetzt,<br />
sind es im Saarland nur 85%. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine abweichende Festsetzung durch<br />
Rechtsverordnung möglich, dies fand allerdings noch keine Anwendung. Als Besonderheit ist die Verwendung<br />
einer Einwohnerschwelle in Niedersachsen zu nennen. Für Gemeinden in denen weniger als<br />
100.000 Einwohner gemeldet sind, wird ein Abschlag in Höhe von 10% des gewogenen Landesdurchschnitts<br />
gewährt. Thüringen wird ab 2015 die fiktiven Hebesätze der Gewerbesteuer von 300% auf 357%<br />
erhöhen. Im selben Jahr werden auch die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A und B von 200% respektive<br />
300% auf 271% respektive 389% angehoben. Auffallend ist, dass die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer<br />
B und Gewerbesteuer in <strong>NRW</strong> mit Abstand die höchsten im Ländervergleich sind (vgl. Kapitel 6).<br />
In der Mehrzahl der Länder wird der Gemeindeanteil des Aufkommens der Einkommen- und Umsatzsteuer<br />
vollständig angerechnet. Im Saarland allerdings nur zu 85% und in Niedersachsen nur mit 90%. In<br />
Sachsen-Anhalt wird darüber hinaus das Gewerbesteueraufkommen über 3 Jahre geglättet. Insbesondere<br />
die anteilige Berücksichtigung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kommt Wohngemeinden<br />
zu Gute, während die Verwendung von fiktiven Hebesätzen tendenziell Betriebsgemeinden besserstellt.<br />
Fiktive Bedarfsermittlung: Der Einwohner ist in den Finanzausgleichssystemen aller Flächenländer der<br />
bedarfsverursachende Faktor. Das zentrale Element der fiktiven Bedarfsmessung in <strong>NRW</strong> ist die Hauptansatzstaffel.<br />
Diese beinhaltet einen Faktor zur Gewichtung der Einwohnerzahlen (Einwohnerveredelung),<br />
welcher mit steigender Gemeindegröße ansteigt. Dieses Verfahren findet in allen anderen Flächenländern<br />
– bis auf Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein – ebenfalls Anwendung.<br />
In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig Holstein wird der fiktive<br />
Bedarf der Gemeinden mit Hilfe eines vom jeweilig zuständigen Ministerium festgelegten Grundbetrags<br />
ermittelt. Dieser pauschale Grundbetrag wird pro Einwohner an die Gemeinden ausgeschüttet. In<br />
Rheinland-Pfalz wird der Grundbetrag in Größenklassen unterteilt. Verbandsgemeinden, verbandsfreie<br />
Gemeinden und große kreisangehörige Städte erhalten 34%, Landkreise 66% und kreisfreie Städte 100%<br />
des Grundbetrages multipliziert mit der jeweiligen Einwohnerzahl. Als zusätzliches Element der Bedarfsermittlung<br />
verwendet Schleswig-Holstein den Zentrale-Orte-Ansatz. Dieser dient zum finanziellen Ausgleich<br />
von zentralörtlichen Funktionen. Er orientiert sich hierbei an den Hierarchien der jeweiligen Landesentwicklungspläne.<br />
In diesen werden siedlungsstrukturelle Aufgaben sowie der Bedarf an lokaler<br />
Infrastruktur festgelegt. Häufig erfolgt die Einordnung der zentral-örtlichen Funktionen in Grund-, Mittelund<br />
Oberzentrum. In Schleswig-Holstein ist dieses zusätzliche Element in den Schlüsselzuweisungen verankert.<br />
So werden 11,4% der Schlüsselmasse an Kommunen mit übergemeindlichen Aufgaben ausge-<br />
42