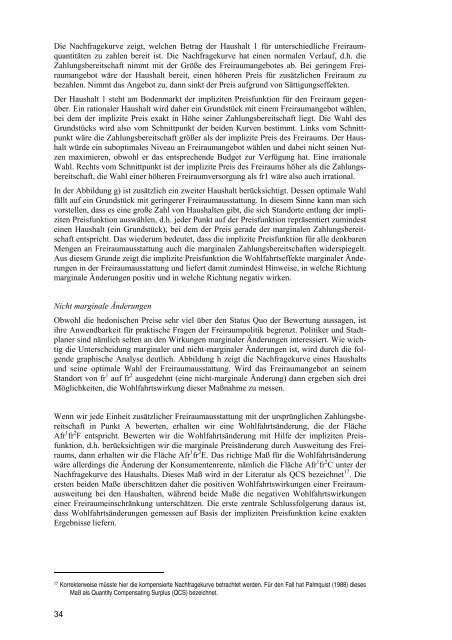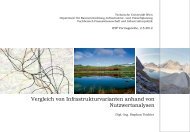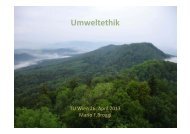Download - IFIP - Technische Universität Wien
Download - IFIP - Technische Universität Wien
Download - IFIP - Technische Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Nachfragekurve zeigt, welchen Betrag der Haushalt 1 für unterschiedliche Freiraumquantitäten<br />
zu zahlen bereit ist. Die Nachfragekurve hat einen normalen Verlauf, d.h. die<br />
Zahlungsbereitschaft nimmt mit der Größe des Freiraumangebotes ab. Bei geringem Freiraumangebot<br />
wäre der Haushalt bereit, einen höheren Preis für zusätzlichen Freiraum zu<br />
bezahlen. Nimmt das Angebot zu, dann sinkt der Preis aufgrund von Sättigungseffekten.<br />
Der Haushalt 1 steht am Bodenmarkt der impliziten Preisfunktion für den Freiraum gegenüber.<br />
Ein rationaler Haushalt wird daher ein Grundstück mit einem Freiraumangebot wählen,<br />
bei dem der implizite Preis exakt in Höhe seiner Zahlungsbereitschaft liegt. Die Wahl des<br />
Grundstücks wird also vom Schnittpunkt der beiden Kurven bestimmt. Links vom Schnittpunkt<br />
wäre die Zahlungsbereitschaft größer als der implizite Preis des Freiraums. Der Haushalt<br />
würde ein suboptimales Niveau an Freiraumangebot wählen und dabei nicht seinen Nutzen<br />
maximieren, obwohl er das entsprechende Budget zur Verfügung hat. Eine irrationale<br />
Wahl. Rechts vom Schnittpunkt ist der implizite Preis des Freiraums höher als die Zahlungsbereitschaft,<br />
die Wahl einer höheren Freiraumversorgung als fr1 wäre also auch irrational.<br />
In der Abbildung g) ist zusätzlich ein zweiter Haushalt berücksichtigt. Dessen optimale Wahl<br />
fällt auf ein Grundstück mit geringerer Freiraumausstattung. In diesem Sinne kann man sich<br />
vorstellen, dass es eine große Zahl von Haushalten gibt, die sich Standorte entlang der impliziten<br />
Preisfunktion auswählen, d.h. jeder Punkt auf der Preisfunktion repräsentiert zumindest<br />
einen Haushalt (ein Grundstück), bei dem der Preis gerade der marginalen Zahlungsbereitschaft<br />
entspricht. Das wiederum bedeutet, dass die implizite Preisfunktion für alle denkbaren<br />
Mengen an Freiraumausstattung auch die marginalen Zahlungsbereitschaften widerspiegelt.<br />
Aus diesem Grunde zeigt die implizite Preisfunktion die Wohlfahrtseffekte marginaler Änderungen<br />
in der Freiraumausstattung und liefert damit zumindest Hinweise, in welche Richtung<br />
marginale Änderungen positiv und in welche Richtung negativ wirken.<br />
Nicht marginale Änderungen<br />
Obwohl die hedonischen Preise sehr viel über den Status Quo der Bewertung aussagen, ist<br />
ihre Anwendbarkeit für praktische Fragen der Freiraumpolitik begrenzt. Politiker und Stadtplaner<br />
sind nämlich selten an den Wirkungen marginaler Änderungen interessiert. Wie wichtig<br />
die Unterscheidung marginaler und nicht-marginaler Änderungen ist, wird durch die folgende<br />
graphische Analyse deutlich. Abbildung h zeigt die Nachfragekurve eines Haushalts<br />
und seine optimale Wahl der Freiraumausstattung. Wird das Freiraumangebot an seinem<br />
Standort von fr 1 auf fr 2 ausgedehnt (eine nicht-marginale Änderung) dann ergeben sich drei<br />
Möglichkeiten, die Wohlfahrtswirkung dieser Maßnahme zu messen.<br />
Wenn wir jede Einheit zusätzlicher Freiraumausstattung mit der ursprünglichen Zahlungsbereitschaft<br />
in Punkt A bewerten, erhalten wir eine Wohlfahrtsänderung, die der Fläche<br />
Afr 1 fr 2 F entspricht. Bewerten wir die Wohlfahrtsänderung mit Hilfe der impliziten Preisfunktion,<br />
d.h. berücksichtigen wir die marginale Preisänderung durch Ausweitung des Freiraums,<br />
dann erhalten wir die Fläche Afr 1 fr 2 E. Das richtige Maß für die Wohlfahrtsänderung<br />
wäre allerdings die Änderung der Konsumentenrente, nämlich die Fläche Afr 1 fr 2 C unter der<br />
Nachfragekurve des Haushalts. Dieses Maß wird in der Literatur als QCS bezeichnet 17 . Die<br />
ersten beiden Maße überschätzen daher die positiven Wohlfahrtswirkungen einer Freiraumausweitung<br />
bei den Haushalten, während beide Maße die negativen Wohlfahrtswirkungen<br />
einer Freiraumeinschränkung unterschätzen. Die erste zentrale Schlussfolgerung daraus ist,<br />
dass Wohlfahrtsänderungen gemessen auf Basis der impliziten Preisfunktion keine exakten<br />
Ergebnisse liefern.<br />
17<br />
Korrekterweise müsste hier die kompensierte Nachfragekurve betrachtet werden. Für den Fall hat Palmquist (1988) dieses<br />
Maß als Quantity Compensating Surplus (QCS) bezeichnet.<br />
34