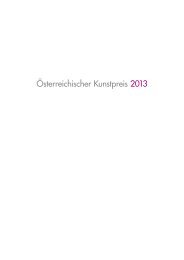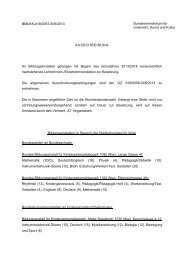Leitfaden zur Implementierung von Schulsozialarbeit
Leitfaden zur Implementierung von Schulsozialarbeit
Leitfaden zur Implementierung von Schulsozialarbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
(3) Erstmalige <strong>Implementierung</strong> (Initial Implementation)<br />
Nach der erstmaligen Einführung <strong>von</strong> <strong>Schulsozialarbeit</strong> befindet sich das Projekt/Angebot<br />
nunmehr in einer Anlauf- und Entwicklungsphase. Diese Phase kann mithin herausfordernd<br />
und problemanfällig sein. Es ist daher wichtig, nachhaltige Problemlösungen zu finden und das<br />
gesamte System(umfeld) kontinuierlich den veränderten Bedingungen anzupassen und zu<br />
optimieren. Vielfach werden die Erwartungen, Ziele, Zuständigkeiten oder Arbeitsweisen der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> bzw. unterschiedlicher HandlungspartnerInnen erst im Laufe praktischer<br />
Umsetzung und Zusammenarbeit klar(er). Alle HandlungspartnerInnen sollten daher<br />
Bereitschaft zeigen, dazuzulernen und neue Praktiken zu übernehmen.<br />
Vorrangiges Ziel dieser Phase ist es, das Projekt/Angebot nicht frühzeitig wieder abzubrechen.<br />
Dazu muss unterschieden werden zwischen Problemen, die sich auf den Prozess der erstmaligen<br />
<strong>Implementierung</strong>, und solchen, die sich auf das Projekt/Angebot als Ganzes beziehen. Dadurch<br />
sollen nachhaltige Lösungen gefördert und vermieden werden, das ganze Projekt/Angebot<br />
vorschnell als unpassend abzuschreiben. Große Anforderungen kommen daher sowohl auf die<br />
PraktikerInnen im schulsozialarbeiterischen Alltag als auch auf die Koordinations- und<br />
Steuerungsfähigkeiten der projekt-/angebotsspezifischen organisatorischen Einrichtungen zu<br />
(z.B. schulinterne/-externe Arbeitsgruppen, Steuer-, Projektgruppen etc.). An diesen liegt es<br />
maßgeblich, die Probleme und Anliegen unterschiedlicher Stakeholder, sowie Jahres-/<br />
Zwischenberichte und Entwicklungstendenzen zu bewerten, zusammenzuführen und<br />
entsprechende Entscheidungen zu treffen.<br />
Begleitende (Selbst-)Evaluation und Qualitätsentwicklung ist empfehlenswert. Die<br />
Evaluation kann entweder durch interne oder durch externe Stellen erfolgen und etwa auf die<br />
Standards und Kriterien des Grundlagenpapiers zu Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität<br />
<strong>zur</strong>ückgreifen (vgl. Zielparameter in Adamowitsch, Lehner, Felder-Puig, 2013). Wichtig für die<br />
Qualitätsentwicklung ist, Ziele und Erwartungen im Hinblick auf projekt-/angebotsspezifische<br />
Rahmenbedingungen, sowie Stärken und Schwächen zu analysieren mit der Absicht, das<br />
gesamte Projekt/Angebot dadurch weiter zu optimieren und noch besser zu integrieren. Es kann<br />
dafür hilfreich sein, diese Phase als eine Pilotphase für das <strong>Schulsozialarbeit</strong>sprojekt/<br />
-angebot zu verstehen, die durchaus einige Jahre in Anspruch nehmen kann (in etwa zwei bis<br />
vier Jahre).<br />
Tipps - Fragen - Erfahrungen aus der Praxis:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Umfassender Support für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erInnen: Präsenz des<br />
Trägers, Umgang mit (divergierenden) Erwartungen<br />
begleitende Evaluation und selbstreflektierte Umsetzung, sowie ständige<br />
Übersetzung in die praktische Arbeit<br />
verpflichtende Supervision für die MitarbeiterInnen ratsam<br />
Transparenz: Sichtbarmachen der Arbeit schafft Vertrauen<br />
Lobbyarbeit für das Handlungsfeld<br />
Balance zwischen Sensibilität für Standort und eigenem/r Profil/Haltung<br />
Kommunikationskultur an den jeweiligen Schulstandorten analysieren<br />
Prioritäten setzen: Rahmenbedingungen (Stundenpotenzial, Budget,…)<br />
auf der einen und die Erfordernisse des Schulstandorts auf der anderen<br />
Seite abgleichen<br />
Übersicht über zu erhebende Daten bewahren (mit Checklisten,<br />
Dokumentationshilfen,…)<br />
Regelmäßige, strukturierte Besprechungen in verantwortlichen<br />
organisatorischen Einrichtungen<br />
<br />
Trial-and-Error-Phase: verlangt hohe Flexibilität und ein freundlichkompetentes<br />
Vorgehen; „Fehler“ müssen möglich sein<br />
LBIHPR | 2013 29