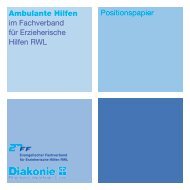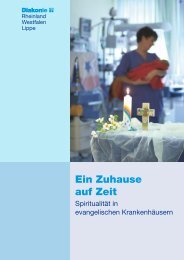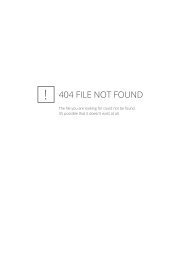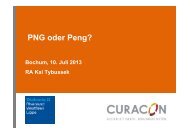„Die multikulturelle Gesellschaft – Konsequenzen für die Diakonie ...
„Die multikulturelle Gesellschaft – Konsequenzen für die Diakonie ...
„Die multikulturelle Gesellschaft – Konsequenzen für die Diakonie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zippert <strong>„Die</strong> <strong>multikulturelle</strong> <strong>Gesellschaft</strong> <strong>–</strong> <strong>Konsequenzen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Diakonie</strong>“ (Vortrag <strong>Diakonie</strong> RWL 19.3.2013 7<br />
Diese Dimension umfasst natürlich <strong>die</strong> jeweilige Motivation, aber auch <strong>die</strong> Zielsetzung<br />
und <strong>die</strong> Brechung oder Beförderung durch persönliche oder beruflichinstitutionelle<br />
Erfahrungen, auch durch <strong>die</strong> Klienten selbst.<br />
Meist zeigt sich <strong>die</strong>se Vielfalt implizit z.B. darin, dass Mitarbeitende in Kirche und <strong>Diakonie</strong><br />
eine <strong>–</strong> verglichen mit anderen Arbeitgebern <strong>–</strong> hohe individuelle Gestaltungsfreiheit<br />
ihres Arbeitsbereiches beanspruchen, meist haben; und wenn sie ihnen nicht<br />
zugebilligt wird, dann ertrotzten oder erschleichen <strong>–</strong> unter stillem oder lautem „Protest“.<br />
Leitung in evangelischen Einrichtungen muss mit der Individualität der Mitarbeitenden<br />
rechnen und ihr Rechnung tragen (ja, das kostet was <strong>–</strong> bringt aber auch was,<br />
nämlich hoch selbständig agierende Mitarbeitende).<br />
Damit sind wir bei einem weiteren Thema: Wie und wo kann man <strong>die</strong>ses diakonische<br />
Handeln von Mitarbeitenden und Leitenden begründen?<br />
4. Theologische Begründungen <strong>für</strong> <strong>die</strong> diakonische Handeln<br />
Kein Theologe wird heute Uhlhorn mit Ernst wiederholen: <strong>„Die</strong> Welt vor Christus war<br />
eine Welt ohne Liebe.“ Liebe und helfendes bzw. unterstützendes Handeln sind bis in<br />
<strong>die</strong> Steinzeit als allgemein menschliches Phänomen nachgewiesen <strong>–</strong> freilich auch ihr<br />
Gegenteil: tödliche Aggressivität und Vernichtung von Leben, das als lebensunwert<br />
gilt. Liebe und Solidarität sind immer bedroht und brauchen Pflege, sprich: „Kultur“.<br />
In jüngster Zeit haben Heinz Rüegger und Christoph Sigrist umfänglich nachgewiesen,<br />
dass, wenn Gott <strong>die</strong> Quelle aller Liebe ist, liebendes, prosoziales Verhalten nicht<br />
allein Folge der Gnade, sondern auch als eine natürliche Gabe <strong>für</strong> alle Menschen<br />
verstanden werden kann. 2 Es gilt nicht nur: Wo Gott ist, ist Liebe, sondern auch: ubi<br />
caritas, deus ibi est. Der Umkehrschluss ist also erlaubt, liturgisch zumindest schon<br />
lange! Ähnlich argumentierten schon Ross und Pompey, wenn sie in Rahners Nachfolge<br />
vom „anonymen Diakonentum“ sprechen (ebd. 125f).<br />
Es sind nicht <strong>die</strong> ersten. Begonnen hat es schon vor über 200 Jahren, als andere<br />
Religionen und Kulturen unübersehbar in den europäischen Horizont traten.<br />
- Johann Gottfried Herder hat in seine „Briefen zur Beförderung der Humanität“ mit<br />
dem aus dem Französischen importierten Wort humanité/„Humanität“ (Menschlichkeit)<br />
einen Begriff eingeführt, der Verständigung über <strong>die</strong> Religionsgrenze hinaus<br />
ermöglicht und immer neu erfordert (Herder 1793-97/1991).<br />
2 <strong>Diakonie</strong> - eine Einführung: Zur theologischen Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011, S. 127.