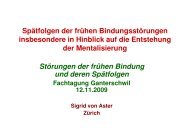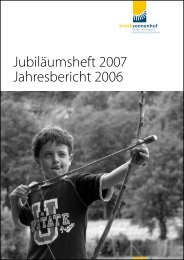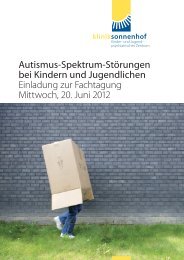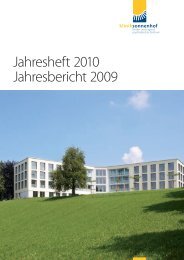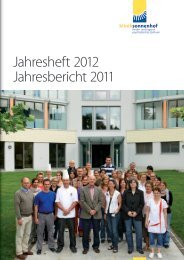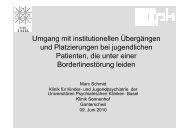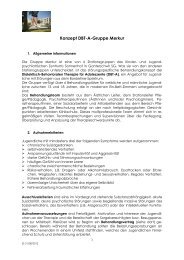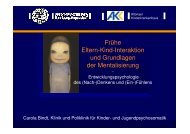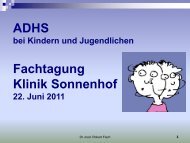Jahresheft 2013 Jahresbericht 2012 - Klinik Sonnenhof
Jahresheft 2013 Jahresbericht 2012 - Klinik Sonnenhof
Jahresheft 2013 Jahresbericht 2012 - Klinik Sonnenhof
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Psychische Gesundheit im Kontext<br />
gesellschaftlicher Veränderung<br />
14<br />
Veränderte Kindheit<br />
Dieses Thema war auch Titel der zweiten Fachtagung<br />
<strong>2012</strong>. Zu Ehren von Robert Fisch referierten<br />
seine Favoriten Prof. Dr. Franz Resch und Prof. Dr.<br />
Reinmar du Bois. Ihre Ausführungen werden hier<br />
zusammengefasst dargestellt.<br />
Lässt sich eine veränderte Kindheit mit neuer Morbidität<br />
in neuen Familienstrukturen, neuen Problemfeldern<br />
in den Bereichen Schule und Arbeitsmarkt,<br />
mit Gebrauch der neuen Medien bei<br />
Risikokonsum in gesellschaftlichen Umbruchzeiten<br />
abbilden? Anzeichen für eine reale Zunahme der<br />
Morbidität in einigen Symptombereichen müssen<br />
von einer scheinbaren Zunahme z.B. durch erhöhte<br />
gesellschaftliche Achtsamkeit, Medikalisierung sozialer<br />
Probleme und Inkonsistenz der Normen und<br />
Definitionen differenziert werden. Die Realzunahme<br />
in den Bereichen Selbstverletzung und Suizidalität,<br />
bei psychosomatischen Symptomen und bei<br />
schizophrenen Ausdrucksformen bildet sich auch<br />
im DSM V, der Revision des Klassifikationssystems<br />
der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung<br />
mit einigen neuen Diagnosen ab.<br />
Ob Familien mit der Zunahme von Scheidungen,<br />
Patchworkfamilien, Bindungsschwäche, dem Syndrom<br />
der kalten Schulter, Zeitmangel, Konflikten<br />
und Erschöpfung allgemein tatsächlich häufiger<br />
oder intensiver psychisch erkranken, beantwortet<br />
F. Resch mit dem Satz: «Die Familie ist nicht krank,<br />
aber es gibt kranke Familien». Er fokussiert hier vor<br />
allem auf die Kinder psychisch kranker Eltern, deren<br />
Entwicklung hier durch den schon früh gestörten<br />
emotionalen Dialog zwischen Eltern und Kind leidet.<br />
Aber auch in Schule und Arbeitswelt stattfindende<br />
Veränderungen beeinflussen kindliche und<br />
jugendliche Entwicklung nachhaltig: Die frappante<br />
Zunahme des Schulschwänzens und der Jugendarbeitslosigkeit<br />
stehen hier als Symptome einer<br />
schwerwiegenden, unzumutbaren und dringend<br />
änderungsbedürftigen gesellschaftlichen Notlage.<br />
Mit dem früh möglichen, breiten Zugang zu neuen<br />
Medien sind Kinder und Jugendliche zunehmend<br />
und früher Themen wie Pornografie, Cybermobbing,<br />
Bullying und Happy slapping (öffentlich gemachte<br />
Prügelvideos) ausgesetzt und müssen sich<br />
– meist ohne, dass Erwachsene überhaupt etwas<br />
davon mitbekommen – mit diesen mindestens<br />
von einem Drittel als unangenehmen erlebten Erfahrungen<br />
auseinandersetzen und abgrenzen.<br />
Auch das Risikoverhalten ändert sich mit der gesell-<br />
schaftlichen Veränderung: Computersucht, der<br />
zunehmde Konsum illegaler (Party-)Drogen und<br />
Mixgetränke sind wiederum Beispiele für neue<br />
Herausforderungen an jugendliche Entwicklung.<br />
Zeit des Umbruchs<br />
Heute steht der sich entwickelnde Mensch bei<br />
Informationsvielfalt, bei hoher Komplexität der<br />
Kontexte, bei Wertepluralität, bei einem Übermass<br />
an Positivität (Überfluss) unter hohem Erfolgsdruck<br />
und Konkurrenz. Komplizierend bzw. herausfordernd<br />
kommen Globalisierung, hohe Mobilität und<br />
Flexibilitätsanforderung hinzu. Der Qual der Wahl<br />
stehen die Chancen des Handelns gegenüber. Dies<br />
führt zu hohen Anforderungen an sich entwickelnde<br />
Kinder und Jugendliche: Hohe Ausbildungs-/<br />
Bildungsqualität, hohe Selbststeuerung/Selbstreflektion<br />
und hohe kommunikative Kompetenz sind<br />
oft unerreichbare Ziele. Therapeuten müssen hier<br />
individuelle Strategien erarbeiten, soziale Systeme<br />
können durch sie nicht erlöst werden, auch wenn<br />
dies oft erwartet wird. Individualisierte bio-psychosoziale<br />
Hilfe muss nach differenzierter Problemanalyse<br />
durch Integration, nicht durch Fragmentierung<br />
der Helfersysteme erfolgen.<br />
Anpassung und Entwicklung<br />
Junge Patienten als «schwankende Zeitgenossen»<br />
müssen selbst dafür sorgen, dass man sich über<br />
deren Entwicklung ständig Gedanken macht. Dabei<br />
ist die Abgrenzung von Gesundheit gegen<br />
Krankheit, von Behandlungsbedürftigkeit gegen<br />
Nichtbehandlungsbedürftigkeit äusserst unscharf<br />
und gelegentlich willkürlich.<br />
Verschiedene Konzepte der psychischen Entwicklung<br />
existieren. Sie beziehen sich auf die Entwicklung<br />
des Körpers, auf die Entwicklung von Störeinflüssen<br />
und Traumata, auf die Entwicklung der<br />
Sexualität und der Autonomie, auf die Entwicklung<br />
von Bindung und Beziehungen oder auf die<br />
Entstehung biografischer Sinnzusammenhänge.<br />
Daneben formulieren Konzepte psychischer Entwicklung<br />
die Entwicklung von Anpassungsleistungen<br />
versus Entstehung von Vulnerabilität, die<br />
Entwicklung bzw. der Verlauf psychopathologischer<br />
Phänomene. Die Entwicklung ist nach moderner<br />
Auffassung ein lebenslanger interaktiver<br />
und autopoetischer Prozess, er durchläuft eine<br />
Kreisbahn, führt also immer wieder an denselben<br />
Punkten und Figuren vorbei. Die moderne Entwicklungstheorie<br />
geht von Entwicklungsaufgaben<br />
aus, die zu lösen sind.<br />
Vulnerabilität und äussere Einflüsse<br />
Die Entstehung der Empfindlichkeit (Vulnerabilität)<br />
für eine bestimmte Krankheit und schliesslich auch<br />
die Entwicklung von dort zu einer manifesten Erkrankung<br />
wird intensiv beforscht, Vulnerabilität ist<br />
nach allen vorliegenden Forschungen ein nützliches,<br />
aber zugleich ein irritierend offenes und<br />
vielgestaltiges Konzept, das keine klare Prognose<br />
hinsichtlich einer psychischen Erkrankung bietet.<br />
Der Einfluss, den äussere Ereignisse auf die sichtbare<br />
Symptomatik haben, bleibt während der gesamten<br />
Kindheit und bis ins Jugendalter sehr hoch.<br />
Inzwischen wird von allen Seiten stärker betont,<br />
dass auch schon in der Kindheit die seelischen<br />
Strukturen ein Beharrungsmoment besitzen und<br />
nicht durch beliebige Einflüsse beliebig änderbar<br />
sind. Vielmehr muss man bedenken, dass bestimmte<br />
hirnfunktionsbasierte Anlagen und sich<br />
daraus ergebende Erziehungs- und Verhaltensschwierigkeiten<br />
einem Kind allzu pauschal zugeschrieben<br />
werden könnten und ein Kind unnötig<br />
pathologisiert werden könnte.<br />
Bedeutung traumatischer Erfahrungen<br />
Die Bedeutung traumatischer Erfahrungen wird<br />
am Durchleben einer akuten erstmaligen psychischen<br />
Erkrankung sehr deutlich, obwohl dies eher<br />
selten thematisiert wird. Die «life event»-Forschung,<br />
aber auch die Trauma-Forschung reflektiert allerdings<br />
nur einen winzigen Lebensausschnitt. Sie<br />
ignoriert die fortgesetzte Umbildung oder Verwerfung<br />
von Persönlichkeitsstrukturen. Die Gedächtnisforschung<br />
hat bestätigt, dass psychisches Leid<br />
nicht nur aus der pathologischen Verdrängung,<br />
sondern aus primitiven desorganisierten Gedächtnisspuren<br />
hervorgeht.<br />
Berücksichtigt man Aspekte von Beziehung und<br />
Bindung, so wird deutlich, dass die reziproke Bezogenheit<br />
von Kindern und Eltern ein roter Faden<br />
durch die gesamte Entwicklung ist: Eine mächtige<br />
intrapsychische und eine ebenso mächtige interpersonale<br />
und soziale Realität, die nie aufhört,<br />
auch nicht etwa durch die Autonomieentwicklung.<br />
Autonomie und Eigenkontrolle sind nur die halbe<br />
Wahrheit über die menschliche Entwicklung: In<br />
Wahrheit verbleibt die seelische Struktur zeitlebens<br />
in einem intermediären Raum, wo sie teilweise nur<br />
durch ihre Überschneidungen mit dem seelischen<br />
Leben anderer Menschen sinnvoll beschrieben<br />
und erhalten werden kann. Autonomie kann in<br />
einem Entwicklungsmodell, das nicht linear auf das<br />
Erreichen eines definitiven Ziels ausgerichtet ist,<br />
nur als Idealnorm vorkommen.<br />
Entwicklungsorientierte Psychopathologie<br />
Die Leitidee der Entwicklungsorientierten Psychopathologie<br />
deutet pathologische Symptome als<br />
Überreste einer früheren Struktur des Verstehens.<br />
Am Beginn und im Vorfeld schizophrener Psychosen<br />
muss zum Beispiel das gesamte Reserve- und<br />
Notrepertoire frühkindlicher Verhaltens- und Erlebnismuster<br />
aufgeboten werden – als Versuch, den<br />
drohenden psychischen Zusammenbruch aufzuhalten.<br />
Der Erkrankung vorausgehende Auffälligkeiten<br />
im Reifezustand und in der Entwicklungsdynamik<br />
bietet auch den entscheidenden psychotherapeutischen<br />
Zugang.<br />
Die gestörte Reifeentwicklung der Schizophrenen<br />
ist somit nicht zufälliges Beiwerk, sondern essenzieller<br />
Bestandteil der Erkrankung. In psychischen<br />
Krankheiten kehren also nicht nur Verhaltensmuster,<br />
sondern auch Beziehungsfiguren zurück,<br />
die während der Kindheit wirksam und sinnvoll<br />
waren, und die nun für den therapeutischen Zugang<br />
genutzt werden können. Die Symptome<br />
eines Patienten können – über die Personengrenzen<br />
hinweg – als Hilferuf einer Bezugsperson aufgefasst<br />
werden.<br />
Zu den entwicklungsorientierten therapeutischen<br />
Techniken zählt auch das Spiel – kurioserweise in<br />
der Psychiatrie der Erwachsenen fast eine «terra<br />
incognita». Spielerische Therapietechniken können<br />
ein therapeutisches Vakuum füllen, das sich vor<br />
allem im Umgang mit dissoziativen Störungen und<br />
in der Behandlung wenig reflektierter, agierender<br />
und somatisierender Patienten auftut. Je länger ein<br />
kindliches Verhalten zurückverfolgt werden kann<br />
und der Krankheit vorausläuft, desto eher imponiert<br />
es nicht mehr als «krankhafte Regression»,<br />
sondern als «persönlichkeitsgebundene Retardierung».<br />
Das Wissen, dass ein Patient schon lange vor<br />
seiner psychischen Krise dieselben oder ähnliche<br />
charakterlichen Absonderlichkeiten aufgewiesen<br />
hat, schafft einen vollkommen anderen – nämlich<br />
niedrigeren – Erwartungshorizont für die Therapie.<br />
Dr. med. Ulrich Müller-Knapp<br />
Chefarzt<br />
15