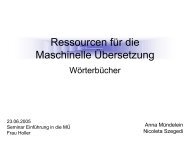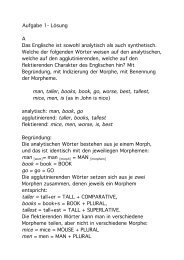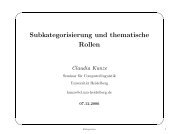Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gelten, solange sie im Text nicht explizit außer Kraft gesetzt werden. 19 Eine vollständige Welt-<br />
beschreibung ohne solche Defaultannahmen ist unmöglich. Die Annahme einer völligen Ei-<br />
gengesetzlichkeit des fiktionalen Textes, wie Durst sie versucht, widerspricht der menschlichen<br />
Wahrnehmungsweise und die Interpretation übernatürlicher Elemente als explizit gemachte lite-<br />
rarische Techniken scheint mir am Kern ihrer Wirkung vorbei zu gehen. Die Überraschung (und<br />
möglicherweise auch Verstörung) angesichts solcher Verstöße ergibt sich nicht aufgrund der<br />
Offenlegung literarischer Kunstgriffe, sondern aufgrund der Diskrepanz zur Erfahrungswirk-<br />
lichkeit.<br />
Bezüge zur nichtfiktionalen Wirklichkeit werden also bei der Analyse eine Rolle spielen. Aller-<br />
dings soll weder eine objektive Wirklichkeit postuliert, noch mit der Auffassung des individuel-<br />
len Lesers argumentiert werden. Grundlage soll vielmehr das außerliterarische belief system<br />
sein, also die Menge der Konzepte, die das Weltbild der Autoren und der Zeitgenossen in ihrem<br />
Kulturkreis, der intendierten Leserschaft, ausmachen. Dieses bezeichne ich mit dem Begriff<br />
‚Erfahrungswirklichkeit‘. Auch dieses Vorgehen ist nicht unproblematisch, denn es gibt sicher-<br />
lich Grauzonen, was zur Erfahrungswirklichkeit gezählt werden kann. Ein Bezug zum außerlite-<br />
rarischen Realitätsempfinden erscheint aber unverzichtbar, um die Wirkung phantastischer El-<br />
emente zu erklären. Einen Verstoß gegen die Erfahrungswirklichkeit bezeichne ich als<br />
‚übernatürlich‘, was nicht automatisch gleichzusetzen ist mit ‚phantastisch‘.<br />
Beim Gebrauch des Begriffs ‚Phantastik‘ werde ich mich nicht an der minimalistischen Defini-<br />
tion orientieren. Das Kriterium der Unentscheidbarkeit zwischen wunderbarer oder rationaler<br />
Erklärung eines Phänomens zur Bestimmung des Phantastischen ist, wie häufig kritisiert wurde,<br />
in Gefahr, <strong>von</strong> der Leserwahrnehmung abzuhängen und es ergibt sich auch das oft angeführte<br />
Problem, dass ein Text durch einen einzigen angefügten Satz, der die Auflösung bringt, das<br />
Genre wechseln kann. 20 Abgesehen da<strong>von</strong> hat die Verwendung der minimalistischen Termino-<br />
logie in Hinblick auf die hier behandelten Texte nicht den Vorteil größerer Präzision, da in die-<br />
sen keine Unentscheidbarkeit vorliegt, sie also <strong>von</strong> vornherein dem Wunderbaren zugeordnet<br />
werden müssten und man also nur immer den Begriff ‚Phantastisches‘ durch ‚Wunderbares‘ er-<br />
setzen würde. Auf Todorovs phantastische Unschlüssigkeit und den vom ihm eingeführten Be-<br />
griff des ‚Unheimlichen‘ wird allerdings an einigen Stellen der Arbeit Bezug genommen, wenn<br />
sie hilfreich zur Beschreibung der Wirkung des Phantastischen sind.<br />
Ich gebrauche den Begriff ‚Phantastik‘ weitgehend im Sinne der historischen maximalistischen<br />
Definition, wobei allerdings die innerliterarische Normrealität der Hintergrund ist, vor dem er<br />
definiert wird. Dabei ist es entscheidend, dass eine Spannung zwischen dieser und den phantas-<br />
tischen Elementen spürbar ist, selbst wenn die phantastischen Elemente als real akzeptiert wer-<br />
19. Siehe Blume: Fiktion und Weltwissen, S. 83-85.<br />
20. Siehe z.B. Blume: Fiktion und Weltwissen, S. 139f.<br />
- 10 -