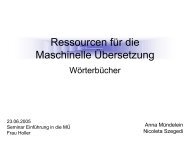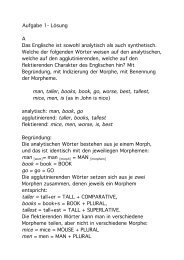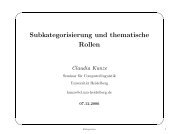Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Isabella von Ägypten - Universität Heidelberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.2 Scheinbare Phantastik und phantastische Grenzfälle<br />
Wenn Neumann <strong>von</strong> dem dritten Element in der Erzählung spricht, dem „irrealen, magi-<br />
schen“ 75 , bezieht er sich vor allem auf die Sagengestalten Alraun, Golem und Bärnhäuter, die<br />
die wichtigsten phantastischen Elemente in der Erzählung darstellen. Neben diesen eindeutig<br />
übernatürlichen Elementen gibt es in der Erzählung aber auch Stellen, die mit dem Konzept des<br />
Phantastischen spielen, ohne es ganz zu erfüllen, und damit zur Komplexität des Wirklichkeits-<br />
gefüges beitragen.<br />
3.2.1 Das Unheimliche<br />
Das ‚Unheimliche‘ oder ‚explizierte Übernatürliche‘ ist der Begriff, den Todorov für eine<br />
Nachbarkategorie des Phantastischen verwendet, diejenigen Elemente eines Textes, die zwar<br />
zunächst übernatürlich erscheinen, sich dann aber als rational erklärbar erweisen. 76 Auch wenn<br />
in dieser Arbeit nicht Todorovs minimalistische Phantastikdefinition zugrunde gelegt wird, han-<br />
delt es sich dennoch um eine Kategorie, die auch dem Phantastischen nach maximalistischer<br />
Definition eng verwandt ist. Im Folgenden soll darum der Begriff im Todorov‘schen Sinne ver-<br />
wendet werden.<br />
Obwohl die Akzeptanz der phantastischen Elemente in der Normrealität relativ hoch ist, leiden<br />
die Protagonisten auch unter undefinierbaren Ängsten vor dem Übernatürlichen und erstaunli-<br />
cherweise sind es Momente, in denen kein wirklich übernatürliches Ereignis vorliegt, in denen<br />
diese am deutlichsten zutage treten.<br />
Das hervorstechendste Beispiel ist Karls erste Begegnung mit <strong>Isabella</strong>, eine Szene, die typische<br />
Merkmale einer (rational auflösbaren) Schauergeschichte aufweist. Das Haus, in dem <strong>Isabella</strong><br />
lebt, „war schon seit zehn Jahren der Gespenster wegen unbewohnt geblieben“ (IÄ, S. 626), je-<br />
doch handelt es sich bei diesen ‚Gespenstern‘ um eine Täuschung, die die Zigeuner bewusst<br />
aufgebaut haben, um zuerst den ursprünglichen Besitzer und danach alle neuen Interessenten zu<br />
vertreiben. Es wird sogar erklärt, wie sie dabei vorgegangen sind, als Braka <strong>Isabella</strong> erinnert,<br />
„wie dein Vater einen, der sich durchaus hier nieder lassen wollte, mit Ruten gehauen, die vie-<br />
len Eulen, die er in einer Kammer eingesperrt hatte und sie einem andern um den Kopf fliegen<br />
ließ [...].“ (IÄ, S. 629) Die Zigeuner nutzen bewusst die Ängste der anderen Menschen aus und<br />
erzeugen mit einfachen Mitteln eine Atmosphäre, die an Übernatürliches glauben lässt. Karls<br />
Entschluss, in dem Gespensterhaus zu übernachten, ein typisches Motiv der Schauerliteratur,<br />
zeigt den Versuch, diese irrationale Angst durch Vernunft zu besiegen: „[D]ie Ammenmärchen<br />
<strong>von</strong> Geistern schreckten ihn aber nicht mehr.“ (IÄ, S. 631) – zu Recht, wie der Leser an dieser<br />
Stelle bereits weiß.<br />
<strong>Isabella</strong> spielt ihre Rolle in der Inszenierung des Übernatürlichen fast automatisch und auf un-<br />
75. Neumann: Legende, Sage und Geschichte, S. 299.<br />
76. Siehe Todorov: Einführung in die fantastische Literatur, S. 40.<br />
- 30 -