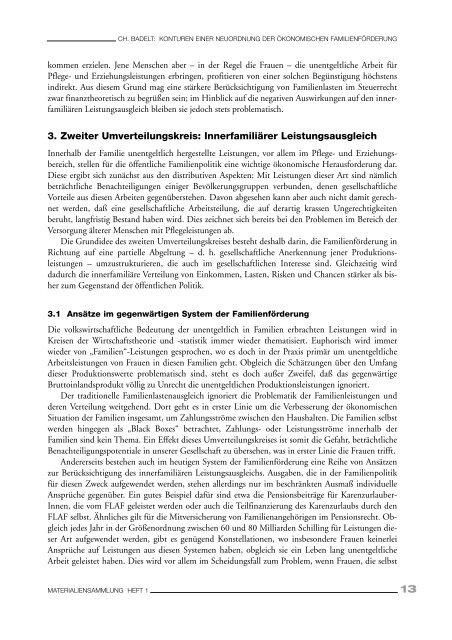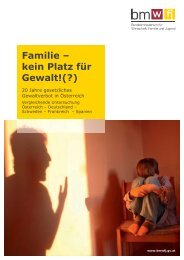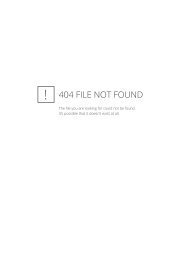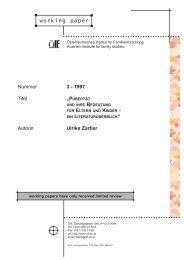5. Interdisziplinäres Symposium Familienforschung ...
5. Interdisziplinäres Symposium Familienforschung ...
5. Interdisziplinäres Symposium Familienforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CH. BADELT: KONTUREN EINER NEUORDNUNG DER ÖKONOMISCHEN FAMILIENFÖRDERUNG<br />
kommen erzielen. Jene Menschen aber – in der Regel die Frauen – die unentgeltliche Arbeit für<br />
Pflege- und Erziehungsleistungen erbringen, profitieren von einer solchen Begünstigung höchstens<br />
indirekt. Aus diesem Grund mag eine stärkere Berücksichtigung von Familienlasten im Steuerrecht<br />
zwar finanztheoretisch zu begrüßen sein; im Hinblick auf die negativen Auswirkungen auf den innerfamiliären<br />
Leistungsausgleich bleiben sie jedoch stets problematisch.<br />
3. Zweiter Umverteilungskreis: Innerfamiliärer Leistungsausgleich<br />
Innerhalb der Familie unentgeltlich hergestellte Leistungen, vor allem im Pflege- und Erziehungsbereich,<br />
stellen für die öffentliche Familienpolitik eine wichtige ökonomische Herausforderung dar.<br />
Diese ergibt sich zunächst aus den distributiven Aspekten: Mit Leistungen dieser Art sind nämlich<br />
beträchtliche Benachteiligungen einiger Bevölkerungsgruppen verbunden, denen gesellschaftliche<br />
Vorteile aus diesen Arbeiten gegenüberstehen. Davon abgesehen kann aber auch nicht damit gerechnet<br />
werden, daß eine gesellschaftliche Arbeitsteilung, die auf derartig krassen Ungerechtigkeiten<br />
beruht, langfristig Bestand haben wird. Dies zeichnet sich bereits bei den Problemen im Bereich der<br />
Versorgung älterer Menschen mit Pflegeleistungen ab.<br />
Die Grundidee des zweiten Umverteilungskreises besteht deshalb darin, die Familienförderung in<br />
Richtung auf eine partielle Abgeltung – d. h. gesellschaftliche Anerkennung jener Produktionsleistungen<br />
– umzustrukturieren, die auch im gesellschaftlichen Interesse sind. Gleichzeitig wird<br />
dadurch die innerfamiliäre Verteilung von Einkommen, Lasten, Risken und Chancen stärker als bisher<br />
zum Gegenstand der öffentlichen Politik.<br />
3.1 Ansätze im gegenwärtigen System der Familienförderung<br />
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der unentgeltlich in Familien erbrachten Leistungen wird in<br />
Kreisen der Wirtschaftstheorie und -statistik immer wieder thematisiert. Euphorisch wird immer<br />
wieder von „Familien“-Leistungen gesprochen, wo es doch in der Praxis primär um unentgeltliche<br />
Arbeitsleistungen von Frauen in diesen Familien geht. Obgleich die Schätzungen über den Umfang<br />
dieser Produktionswerte problematisch sind, steht es doch außer Zweifel, daß das gegenwärtige<br />
Bruttoinlandsprodukt völlig zu Unrecht die unentgeltlichen Produktionsleistungen ignoriert.<br />
Der traditionelle Familienlastenausgleich ignoriert die Problematik der Familienleistungen und<br />
deren Verteilung weitgehend. Dort geht es in erster Linie um die Verbesserung der ökonomischen<br />
Situation der Familien insgesamt, um Zahlungsströme zwischen den Haushalten. Die Familien selbst<br />
werden hingegen als „Black Boxes“ betrachtet, Zahlungs- oder Leistungsströme innerhalb der<br />
Familien sind kein Thema. Ein Effekt dieses Umverteilungskreises ist somit die Gefahr, beträchtliche<br />
Benachteiligungspotentiale in unserer Gesellschaft zu übersehen, was in erster Linie die Frauen trifft.<br />
Andererseits bestehen auch im heutigen System der Familienförderung eine Reihe von Ansätzen<br />
zur Berücksichtigung des innerfamiliären Leistungsausgleichs. Ausgaben, die in der Familienpolitik<br />
für diesen Zweck aufgewendet werden, stehen allerdings nur im beschränkten Ausmaß individuelle<br />
Ansprüche gegenüber. Ein gutes Beispiel dafür sind etwa die Pensionsbeiträge für Karenzurlauber-<br />
Innen, die vom FLAF geleistet werden oder auch die Teilfinanzierung des Karenzurlaubs durch den<br />
FLAF selbst. Ähnliches gilt für die Mitversicherung von Familienangehörigen im Pensionsrecht. Obgleich<br />
jedes Jahr in der Größenordnung zwischen 60 und 80 Milliarden Schilling für Leistungen dieser<br />
Art aufgewendet werden, gibt es genügend Konstellationen, wo insbesondere Frauen keinerlei<br />
Ansprüche auf Leistungen aus diesen Systemen haben, obgleich sie ein Leben lang unentgeltliche<br />
Arbeit geleistet haben. Dies wird vor allem im Scheidungsfall zum Problem, wenn Frauen, die selbst<br />
MATERIALIENSAMMLUNG HEFT 1 13