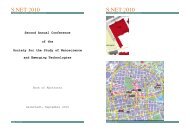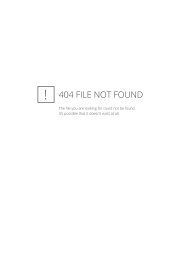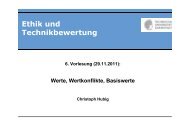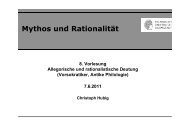Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Adaption begriffen wird. Ergebnis ihrer Aktualisierung im kausalen Prozessieren wäre die<br />
Reaktion auf Störungen des entsprechenden Fließgleichgewichts, welche entweder <strong>zu</strong> dessen<br />
Wiederherstellung oder <strong>zu</strong>m Untergang des Organismus führt. Analog <strong>zu</strong>r<br />
standpunktabhängigen Unterscheidung zwischen Mittel <strong>und</strong> Medium im Bereich der Technik<br />
findet sich hier die standpunktunabhängige Unterscheidung zwischen Ursache <strong>und</strong> Medium:<br />
Stickstoffhypertrophie ist eine Ursache für das Ableben eines Baumes <strong>und</strong> Medium der<br />
Regeneration des Waldes. Je nachdem nun, ob Natur als Medium im weiteren Sinne<br />
technomorph gedacht wird als das jedem technisch orientierten Zugriff Vorausliegende, oder<br />
im engeren Sinne technomorph als in ihrem So-Sein technisch induziert, stellt sich das<br />
Verhältnis natürlicher Medialität <strong>zu</strong> technischer Medialität unterschiedlich dar. Dies schließt<br />
die Option ein, die Medialität der Natur als Konzept für dasjenige <strong>zu</strong> reservieren, was sich als<br />
unbestimmte Alterität in Gestalt der Störungen, Überraschungen, Hemmungen bemerkbar<br />
macht. Ein solches Konzept ist seinerseits negativ technomorph: Das nicht Verfügbare<br />
erscheint im Lichte von Ansprüchen auf technischen Zugriff. Nichtverfügbarkeit absolut <strong>und</strong><br />
ggf. als normativ geladenes Konzept – etwa im Sinne einer »Ehrfurcht vor der Schöpfung«,<br />
als Tabu etc. – <strong>zu</strong> thematisieren, ist in dieser Konstellation nicht möglich. Wir werden hierauf<br />
später <strong>zu</strong>rückkommen.<br />
Wenn wir unter dieser Architektonik als Leitfaden nun weiter suchen im Bereich einer als<br />
Medium konzeptualisierten Kultur, wie sie – wie bereits erwähnt – Ernst W. Orth in<br />
phänomenologischer Absicht entwickelt hat, ergibt sich ein komplexeres Bild. Die Frage<br />
richtet sich nach den medialen Vorausset<strong>zu</strong>ngen eines Sich-Orientierens, welches als<br />
Aktualisierung jener Möglichkeiten begriffen wird. Auf der ersten Ebene, derjenigen<br />
potenzieller Ermöglichung, wäre dies der Raum potenzieller Bedeutungsträger, dessen äußere<br />
Medialität durch das, was überhaupt tradiert ist (im Unterschied <strong>zu</strong>m nicht Tradierten <strong>und</strong><br />
Vergessenen), <strong>und</strong> dessen innere Medialität angelegt ist in den Kriterien, unter denen wir<br />
Sinnhaftes von Sinnlosem unterscheiden. Die Performanz dieser Medialität als realer<br />
Ermöglichung wäre gegeben durch die realen, epistemischen <strong>und</strong> normativen Schemata oder<br />
Dispositive (Foucault), als in ihrer Einheit anschaubare Regeln, <strong>zu</strong> denen man in ein<br />
Verhältnis treten kann. 36 Der Übergang exemplifiziert sich etwa im Unterschied zwischen<br />
bloßen »Räumen« hin <strong>zu</strong> traditionsgeladenen »Orten« (– eine Leitdifferenz wie sie<br />
neuerdings fruchtbar für die Analyse des Cyberspace eingesetzt wird, in dem lediglich noch<br />
Räume bereitgestellt werden, was manche veranlaßt, hier von einem Kulturverlust,<br />
36 Vgl. Anmerkung 16.<br />
17