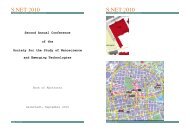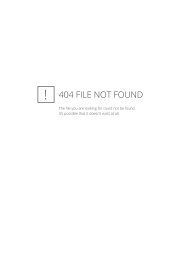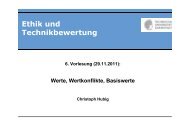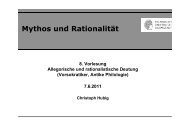Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Natur« und »Kultur«: Von Inbegriffen zu Reflexionsbegriffen1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zwischen Gegenständen <strong>und</strong> Gegenstandsbereichen, sondern an bestimmten Gegenständen<br />
vorgenommen werden. Was ist der logische Ort dieser Unterscheidungen an Gegenständen?<br />
Aus der Verwendung der Inbegriffe von Technik, Natur, Kultur konnten wir entnehmen, daß<br />
ein einheitliches Interesse oder Bemerken unterstellt werden muß. Dieses Interesse ist<br />
dasjenige an einer Bestimmung jeweils spezifischer Faktoren einer Sicherung des<br />
Verhältnisses zwischen dem Subjekt <strong>und</strong> seinem Gegenstandsbereich. Es geht also um ein<br />
Verhältnis <strong>zu</strong> einem Verhältnis. Objektstufige Charakterisierungen sind abkünftig <strong>und</strong> stehen<br />
unter dieser Einheitlichkeit des Bemerkens. Es sind Vorstellungen, die unter jenen<br />
Verhältnissen produziert werden. Wie kommen diese Verhältnisse <strong>zu</strong> den Verhältnissen<br />
<strong>zu</strong>stande? Entsprechend der anfangs erwähnten Aporie könnte die erste Antwort eines<br />
Naturalismus, der hier in die »überschwängliche Metaphysik« Schellings umschlägt, lauten:<br />
Die Natur liegt »als äußere Welt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres<br />
Geistes wieder<strong>zu</strong>finden«. 39 Ihr Ganzes ist so beschaffen, daß es die Struktur des Ich »als<br />
Verhältnis eines Verhältnisses im Verhältnis <strong>zu</strong> sich <strong>und</strong> <strong>zu</strong> anderen <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Welt <strong>zu</strong> stehen«<br />
hervorgebracht hat <strong>und</strong> einschließt. 40 Die zweite Seite des Dilemmas, die die<br />
Unhintergehbarkeit reflexiver Distanz herausstellt, findet sich paßgenau in der Formulierung<br />
des Schelling-Kritikers Kierkegaard:<br />
»Der Mensch ist Geist. Doch was ist Geist? Geist ist das Selbst. Doch was ist das<br />
Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich <strong>zu</strong> sich selbst verhält, oder es ist in<br />
diesem Verhältnis jenes, daß dieses <strong>zu</strong> sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das<br />
Verhältnis, sondern daß sich das Verhältnis <strong>zu</strong> sich selbst verhält. [...] Ein solches<br />
Verhältnis, das sich <strong>zu</strong> sich selbst verhält, ein Selbst, muß sich entweder selbst gesetzt<br />
haben oder durch ein Anderes gesetzt sein.<br />
Ist das Verhältnis, das sich <strong>zu</strong> sich selbst verhält, durch ein Anderes gesetzt, dann ist<br />
das Verhältnis zwar das Dritte, doch dieses Verhältnis, das Dritte, ist dann wiederum<br />
ein Verhältnis <strong>und</strong> verhält sich <strong>zu</strong> dem, was das ganze Verhältnis gesetzt hat«. 41<br />
Kurz: Es bleibt das sich potenzierende Verhältnis. Verhältnisse dieser Art lassen sich nun<br />
näher untersuchen, <strong>und</strong> zwar mit Blick auf ihre vorstellungsermöglichende Kraft. Diese <strong>zu</strong><br />
erfassen, werden so genannte Reflexionsbegriffe eingesetzt, <strong>und</strong> zwar in zweifacher Weise.<br />
39 Friedrich Wilhelm Josef Schelling, Allgemeine Übersicht der neuesten philosophischen Literatur, Historischkritische<br />
Ausgabe Bd. I, 4, Stuttgart 1988, 110.<br />
40 Baumgartner, Natur aus der Perspektive spekulativer <strong>und</strong> kritischer Philosophie, 252.<br />
41 Søren Kierkegaard, Die Krankheit <strong>zu</strong>m Tode, Stuttgart 1997, 13 f. (Herv. C.H.)<br />
19