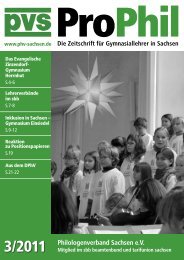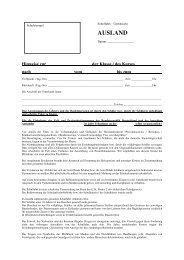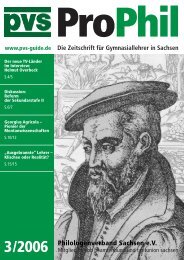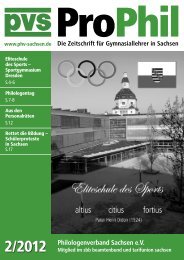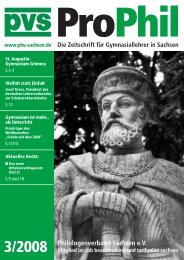Heft lesen... - Philologenverband Sachsen
Heft lesen... - Philologenverband Sachsen
Heft lesen... - Philologenverband Sachsen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Mitglieder in der Diskussion<br />
Gymnasiale Bildung in der Zwickmühle?<br />
Anlässlich eines Kolloquiums<br />
Anfang März im Gymnasium<br />
Einsiedel (Chemnitz)<br />
wurde diese Frage von Mitgliedern<br />
unseres Verbandes<br />
besonders unter dem<br />
Aspekt der Chancen und<br />
Risiken für die gymnasiale<br />
Bildung unter den derzeitigen Bedingungen in <strong>Sachsen</strong> diskutiert.<br />
Im Rahmen der Veranstaltung konnten nur einzelne bildungspolitische Themen<br />
aufgegriffen werden. Dabei kristallisierte sich jedoch letztendlich heraus,<br />
dass das Ziel, dem gymnasialen Anspruch der Ausbildung gerecht zu werden,<br />
stets auch entsprechende berufspolitische Forderungen hervorrufen muss.<br />
In seinem einführenden Vortrag verdeutlichte Gerhard Pöschmann, stellvertretender<br />
Vorsitzender des PVS, die zum Teil widrigen Rahmenbedingungen,<br />
die es uns bereits gegenwärtig erschweren, unseren Bildungsauftrag qualitativ<br />
hochwertig zu erfüllen. Er belegte deren Folgen für unsere Kolleginnen und<br />
Kollegen, ihre Lehrtätigkeit und für die Schülerinnen und Schüler mit konkreten<br />
Beispielen.<br />
In ihrer Eigenschaft als Philologen und Gymnasiallehrer zeigten sich die Teilnehmer<br />
besonders an der Ideenbörse zur „Studierfähigkeit der Abiturienten<br />
und dem Vorwurf mangelnder Kompetenzen“ unter der Leitung von Thomas<br />
Langer (RV Leipzig) interessiert. Sie bestätigten, dass die mangelnde Studierfähigkeit<br />
vieler Absolventen – sei es aufgrund unzureichender sprachlicher<br />
Kompetenzen und kognitiver Fähigkeiten oder fehlender Tugenden wie Anstrengungsbereitschaft<br />
und Beharrlichkeit – bereits vielerorts beklagt wird. Die<br />
Mitglieder wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Erreichen<br />
des Zieles Studierfähigkeit nicht nur ein kontinuierliches und vertieftes Arbeiten<br />
unter entsprechenden schulischen Rahmenbedingungen von Klasse 5 an<br />
erfordert, sondern in Bezug auf vorhandene bzw. notwendige Anforderungsniveaus<br />
auch durch Kooperationen mit Grundschulen einerseits und Hochschulen<br />
andererseits effektiver gestaltet werden könne. Kritisch wurde zudem der<br />
Profilunterricht betrachtet, könnte doch statt dessen mehr Zeit für vertieften<br />
Deutsch- oder MINT-Unterricht zur Verfügung stehen. Außerdem forderten die<br />
Teilnehmer dazu auf, zur Verbesserung der öffentlichen Wertschätzung von<br />
Leistungsbereitschaft beizutragen, die derzeit gültigen Zugangsvoraussetzungen<br />
für ein Lernen am Gymnasium aufrecht zu erhalten und sowohl auf die<br />
geänderten Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler als auch deren<br />
Reizüberflutung durch Medien außerhalb der Schule zu reagieren.<br />
Zu fragen ist aber auch, wen wir wie und mit welchen Zielen ausbilden.<br />
Innerhalb eines gegliederten Schulsystems, für dessen Erhalt sich der <strong>Philologenverband</strong><br />
einsetzt und Bemühungen, dessen Durchlässigkeit auszugestalten,<br />
unterstützt, sind Schullaufbahnberatungen ein wichtiger Bestandteil.<br />
Diese Aufgabe wurde schon immer verantwortungsbewusst und regelmäßig<br />
von den Klassenleitern erfüllt. Ihre explizite Formulierung, wie in §12 der SO-<br />
GYA, wäre somit eigentlich nicht notwendig. So sahen es die Mitglieder, die<br />
unter der Leitung von Markus Gretzschel (RV Dresden) ihre Gedanken und<br />
Erfahrungen zu „Sinn und Unsinn der Bildungsempfehlung in Klasse 6“ austauschten.<br />
Positiv werteten sie die frühe Sensibilisierung der Eltern durch das<br />
neu geregelte Vorgehen. Diskutiert wurde dennoch der Zeitpunkt in Klasse<br />
6: Sollte nicht in einer höheren Jahrgangsstufe eine adäquate Beratung erfolgen?<br />
Gilt es nicht auch, den Charakter der Empfehlung zu hinterfragen?<br />
Zum Erreichen der Studierfähigkeit am Gymnasium ist schließlich der Stand<br />
des Wissenserwerbs von erheblicher Bedeutung. Welche Konsequenzen haben<br />
die Bildungsempfehlungen eigentlich? Der aktuell betriebene bürokratische<br />
Aufwand steht jedenfalls in keinem Verhältnis zum Nutzen, seine Auswirkungen<br />
konnten dagegen in einem deutlichen Mehraufwand für die Klassenleiter,<br />
besonders im Vergleich zur Tätigkeit der Kollegen in anderen Stufen, konkret<br />
definiert werden. Die Teilnehmer dieser Ideenbörse schlugen vor, dass man die<br />
Einschätzung für alle Schüler schriftlich herausgeben und den Eltern das Recht<br />
auf ein Gespräch einräumen sollte. Eine Verpflichtung zum Elterngespräch<br />
ließe sich dann aus einem Beschluss der Klassenkonferenz zur Empfehlung der<br />
Mittelschullaufbahn ableiten. Gefordert wurde dagegen eine Honorierung des<br />
zusätzlichen Zeitaufwandes in geeigneter Form und die Streckung des Zeitraumes<br />
für die Gespräche, da Lehrer der Klasse 6 auch in Abiturprüfungen<br />
involviert sein können.<br />
Chancen und Risiken für die gymnasiale Bildung in <strong>Sachsen</strong> finden sich auch<br />
beim Lehrpersonal und der Absicherung des Unterrichts. Zwei weitere Ideenbörsen<br />
hatten diese Probleme zum Inhalt. Zum einen thematisierte die Gruppe<br />
um Sabine Steinecke (RV Bautzen) die Lehrerausbildung und dabei besonders<br />
den neuen einjährigen Vorbereitungsdienst, zum anderen stellten sich Mitglieder,<br />
moderiert durch Cornelia Krauße (RV Chemnitz), die Frage: „Quereinsteiger<br />
als Gymnasiallehrerinnen und -lehrer?“ Diese konnte mit Bestätigung der<br />
bildungs- und berufspolitischen Ziele unseres Verbandes und der Anzahl der<br />
auch weiterhin zu erwartenden Absolventen mit einer Ausbildung für das gymnasiale<br />
Lehramt im Wesentlichen verneint werden. Die Teilnehmer definierten<br />
zunächst, dass als „Quer- bzw. Seiteneinsteiger“ in den Lehrerberuf derjenige<br />
zu betrachten sei, der mindestens über eine fachwissenschaftliche Ausbildung<br />
(MA oder vergleichbar), jedoch nicht über didaktisch-methodische und pädagogische<br />
Abschlüsse verfügt. Dessen Lehrtätigkeit am Gymnasium kann nur eine<br />
auf konkrete Schulen bezogene Ausnahme sein, die sich zusätzlich auf Mangelfächer<br />
begrenzen muss. Über das Programm Unterrichtsversorgung kurzfristig<br />
(bis zu einem Vierteljahr) eingestellte Personen aus dem oben beschriebenen<br />
Kreis wurden von den Gesprächspartnern nicht als Quereinsteiger, sondern als<br />
– auch preiswertes – „Aushilfspersonal“ betrachtet.<br />
Die bisherigen Positionen zum einjährigen Vorbereitungsdienst konnten<br />
nunmehr auch mit Erfahrungen abgeglichen werden. Die Teilnehmer stellten<br />
fest, dass ein Großteil der Referendare mit einem stärkeren Praxisbezug und<br />
dazu gehörigen Kenntnissen und Fähigkeiten als Jahrgänge zuvor an die Schulen<br />
gekommen waren. Problematisch sahen sie den gewählten Ausbildungszeitraum<br />
vom Februar des einen bis zum Februar des nächsten Jahres, da die<br />
zeitliche Verteilung der Referendarausbildung auf zwei Schuljahre unterschiedliche<br />
schulorganisatorische Folgen, z. B. durch die Abordnung weiterer Fachausbildungsleiter<br />
und die zu gewährenden Mentorenstunden im laufenden<br />
Schuljahr, hat. Außerdem kritisierten die Mitglieder die für die angehenden<br />
Kollegen sowohl vor als auch nach dem Referendariat vorhandenen Zeiträume,<br />
in denen diese nicht ihrer Ausbildung entsprechend arbeiten können, unter<br />
Umständen Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen. Gefordert wurde<br />
an dieser Stelle, den Abschluss der universitären Ausbildung so zu ermöglichen,<br />
dass der Einstieg in das Referendariat anschließend nahtlos am Beginn<br />
eines Schuljahres erfolgen kann. Die Teilnehmer hinterfragten zudem, ob nicht<br />
mit der Neugestaltung der Ausbildung eine Einschränkung der Flexibilität der<br />
jungen Frauen und Männer einherginge, die sich durch mögliche beamtenrechtliche<br />
Konsequenzen für deren Übernahme in den höheren Dienst anderer<br />
Bundesländer ergäbe. Als einen verschiedenen Aspekten gerecht werdenden<br />
Lösungsansatz betrachteten unsere Mitglieder die Ausdehnung des neu gestalteten<br />
12-monatigen Vorbereitungsdienstes auf 18 Monate.<br />
Die Schulleiterin des gastgebenden Gymnasiums Einsiedel (behindertenintegriert),<br />
Kerstin Klein, gewährte den Teilnehmern der Ideenbörse zur Inklusion<br />
einen Einblick in die Arbeit an ihrer Einrichtung, in die Aufgaben und vielfältigen<br />
Anforderungen, die allein schon mit der Integration einzelner behinderter<br />
Schülerinnen und Schüler verbunden sind. Die Mitglieder waren beeindruckt<br />
von den ihnen bisher in diesem Umfang nicht detailliert bewussten Problemstellungen,<br />
die nicht nur aus dem Umgang mit den verschiedenen Handikaps<br />
und dem Willen, wirklich jedem Kind gerecht zu werden, sondern auch aus<br />
dem Kampf um dafür erforderliche Rahmenbedingungen und damit nicht nur<br />
gegen bürokratische Hindernisse resultieren. Einig waren sich die Anwesenden<br />
in der abschließenden Gesprächsrunde, dass trotz aller Bemühungen auch in<br />
Zukunft für einzelne Kinder die beste Förderung und Entwicklung nur an Einrichtungen<br />
mit dem speziell dafür ausgebildeten Personal erfolgen kann. In<br />
diesem Zusammenhang forderten die Mitglieder den Erhalt der Förderschulen.<br />
Das Kolloquium, initiiert und organisiert durch die Vertreter des Chemnitzer<br />
Regionalvorstandes in Anlehnung an deren Stammtisch-Veranstaltungen, darf<br />
als Bereicherung der Verbandsarbeit betrachtet werden. Interessiert und dankbar<br />
nahmen die Mitglieder die Möglichkeit, endlich auch in einem größeren<br />
Rahmen ihre Erfahrungen, Gedanken und Ideen zu bildungs- und berufspolitischen<br />
Themen einbringen zu können, wahr. Die in diesem Artikel zusammengefassten<br />
Aussagen bieten diesbezüglich nur einen kleinen Überblick zu den<br />
Inhalten und Ergebnissen des Gedankenaustausches. Den daran beteiligten<br />
Vertretern des Landesvorstandes obliegt es nun, diese – auch aufgrund ihrer<br />
Brisanz – „zeitnah“ in die öffentliche Positionierung des PVS einfließen zu<br />
lassen. Cornelia Krauße, Vorsitzende des Chemnitzer Regionalvorstandes<br />
1-2013<br />
11