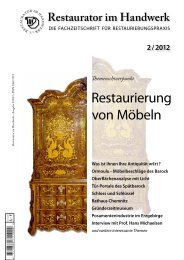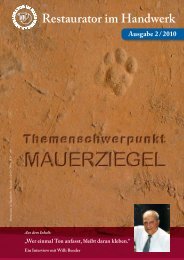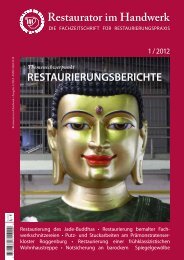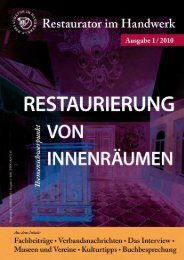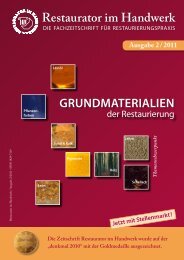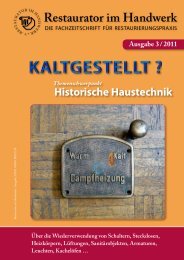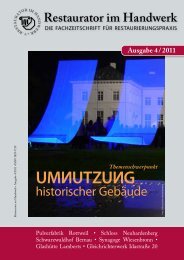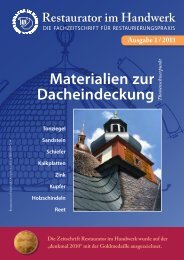Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fachbeiträge<br />
Ra i n e r W. Le o n h a r d t<br />
Historische Mauerziegel für den Wiederaufbau<br />
des Neuen Museums Berlin<br />
Muster- und<br />
Versuchsbau zur<br />
Erprobung der Restaurationsziegel<br />
Das Neue Museum in Berlin, Museum der<br />
Ägyptologie und Vor- und Frühgeschichte, ist das<br />
dritte generalsanierte Haus der fünf Museen der Museumsinsel<br />
Berlin, die 1999 von der UNESCO zum<br />
Weltkulturerbe ernannt wurde.<br />
Das Neue Museum wurde von 1841 bis 1855 nach<br />
den Plänen des Architekten Friedrich August Stüler<br />
gebaut, wobei etwa 20 Millionen Ziegel vermauert<br />
wurden. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört<br />
und stand lange Zeit als Ruine. Für den Wiederaufbau,<br />
der in der Zeit von 2003 bis März <strong>2009</strong> erfolgte,<br />
wurde eine größere Anzahl von Originalziegeln<br />
aus dem 19. Jahrhundert benötigt. Diese Restaurationsziegel<br />
wurden größtenteils von der Firma „antike<br />
baumaterialien für denkmalpflege und restaurierung“<br />
in Berlin-Charlottenburg geliefert. Der Beitrag beschreibt<br />
die Bestandsaufnahme der <strong>im</strong> Neuen Museum<br />
verbauten Mauerziegel, die hieraus abgeleiteten<br />
Qualitätsanforderungen an die zu liefernden Restaurationsziegel,<br />
die Recherche nach Original-Ziegeln<br />
und deren Bergung, Aufarbeitung und Lieferung.<br />
1. Die Bestandsaufnahme<br />
Im Hinblick auf die Rekonstruktion des Neuen Museums<br />
wurde der Bestandsaufnahme der verbauten<br />
Mauerziegel große Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere<br />
auch um Qualitätsparameter für das erforderliche<br />
Austausch- und Ergänzungsziegelmaterial<br />
zu erhalten. Die Untersuchungen hierzu wurden von<br />
Thomas Köberle durchgeführt und bildeten auch die<br />
Abschlussarbeit 1 für das Aufbaustudium Denkmalpflege<br />
in Bamberg <strong>im</strong> Jahre 2001. Zunächst fand eine<br />
Einteilung nach Farbe und Gefüge statt.<br />
Typ I: Alle ziegelroten Ziegel ließen sich der Gegend<br />
um Rathenow zuordnen. Über ihre Farbe hinaus<br />
ließ sich anhand der Ziegelstempel eindeutig Rathenow<br />
als Herstellungsort zuordnen. Gab ein Ziegelstempel<br />
keinen eindeutigen Hinweis, so ermöglichten<br />
Struktur, Porengefüge und Farbe eine Zuordnung.<br />
Typ II: Ziegel dieser Kategorie ließen sich<br />
anhand ihrer Farbe, der Stempel und ihres Gefüges<br />
entweder der Gegend um Werder oder der Stadt Birkenwerder<br />
zuordnen. Zwischen den Ziegeln dieser<br />
beiden Orte bestehen aber farbliche Unterschiede.<br />
Während die Ziegel aus Birkenwerder rein gelb sind,<br />
mit einem leichten Grünstich, sind die Ziegel aus<br />
der Gegend um Werder gelb/rosé teilweise bis ins<br />
Rötliche hinein gesprenkelt und zwar innerhalb eines<br />
Ziegels.<br />
Typ III: In dieser Gruppe wurden die porösen<br />
Ziegel zusammengefaßt, unterschieden nach Kohleziegel<br />
und Infusorienziegel.<br />
Bei allen Ziegeln handelt es sich um ungelochte,<br />
massive Vollsteine. Die folgenden Ausführungen beschäftigen<br />
sich aber nur mit den Ziegeltypen I und II,<br />
da unsere Lieferungen nur diese beiden Ziegeltypen<br />
betrafen.<br />
1.1. Unterscheidungsmerkmale der Ziegel<br />
des Typs I und II<br />
Die Unterschiede sind begründet in dem sehr unterschiedlichen<br />
Tonvorkommen in den drei Regionen<br />
und der Art und Weise ihrer Herstellung.<br />
Der Ton aus der Gegend um Rathenow ist ein so<br />
genannter Elbauenton mit einem recht hohen Anteil<br />
an während des Brennprozesses nicht reaktionsfähigem<br />
Material. Aus diesem Ton gebrannte Ziegel erlangen<br />
keine sehr hohe Festigkeit, verfügen über eine<br />
recht große Wasseraufnahmefähigkeit und haben eine<br />
relativ geringere Druckfestigkeit.<br />
Ganz anders die Situation der Tonvorkommen um<br />
Werder und in Birkenwerder. Die dort vorkommenden<br />
Tonarten haben einen geringen Anteil an nicht<br />
reaktionsfähigem Material, verfügen daher über eine<br />
höhere Festigkeit und nehmen nur geringfügig Wasser<br />
auf.<br />
Diese sehr unterschiedlichen Tonmaterialvorkommen,<br />
aber auch unterschiedliche Verfahren der<br />
Tonaufbereitung machen sich in der Struktur der<br />
gebrannten Ziegel bemerkbar. Die roten Rathenower<br />
26<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2009</strong>