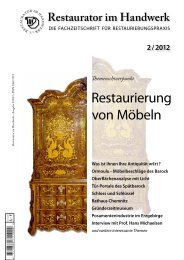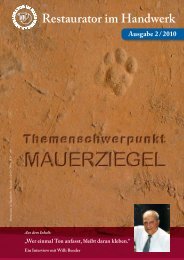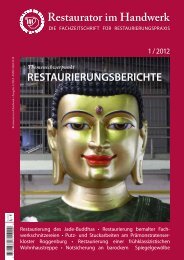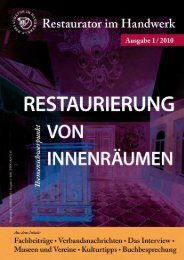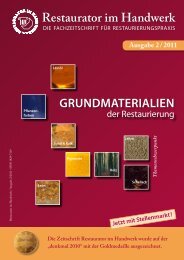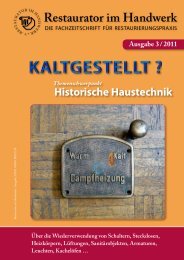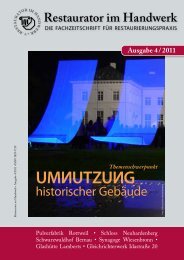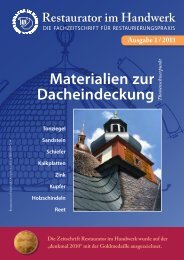Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Interview<br />
Das preußische Pompeji<br />
Interview mit Eva Schad, Martin Reichert<br />
und Anke Fritzsch zum Neuen Museum<br />
Treppenhaus des<br />
Neuen Museums<br />
um 1850<br />
(Stahlstich)<br />
Eva Schad und Martin Reichert sind Architekten und<br />
directors <strong>im</strong> Büro David Chipperfield architects; sie<br />
waren als Projektleiter für das Neue Museum zuständig.<br />
Anke Fritzsch ist Architektin und associate <strong>im</strong> Büro<br />
David Chipperfiled architects, am Neuen Museum hatte<br />
sie die Teamleitung „Restaurierung“.<br />
RIH: Sie haben ein Gebäude vorgefunden, das<br />
nicht nur durch den Krieg zerstört war, sondern auch<br />
durch Umbaumaßnahmen, durch Vernachlässigung,<br />
mit einem sehr viel schichtigen Zerstörungsgrad. Wie<br />
geht man an ein solchen Bau heran, wie ent wickelt<br />
man da ein Konzept?<br />
Martin Reichert: Eine der zentralen Aussagen unseres<br />
Beitrags zum Wettbewerb war, dass der Wiederaufbau<br />
der Ruine des Neuen Museums nicht vorrangig<br />
ein Architekturprojekt sein kann, sondern zu<br />
allererst ein Denkmal pflege projekt sein sollte und dass<br />
der Umgang mit dem Denkmalbestand den Maßgaben<br />
einer seriösen Restaurierung unterliegt, ohne dass<br />
es <strong>im</strong> Detail schon ganz konkrete Überlegungen zur<br />
Wertung einzelner Denkmal schichten gegeben hätte.<br />
Es ging uns also ganz ausdrücklich nicht darum,<br />
das Über kommene als Ausgangspunkt für eine tiefgreifende<br />
Neu interpretation zu nutzen – was ja die<br />
meisten anderen Architekten <strong>im</strong> Wettbewerb getan<br />
hatten.<br />
Von Seiten des Landes denkmalamtes lag ja weder<br />
<strong>im</strong> Vorfeld des Wettbewerbs noch danach eine klassische<br />
„denkmalpflegerische Zielstellung“ vor, son dern<br />
es gab lediglich ein von Prof. Wolfgang Wolters initiiertes<br />
Gutachten, das sogenannte „Denkmal pflegerisches<br />
Plädoyer zur ergänzenden Wieder herstellung“,<br />
dessen Verbindlichkeit für die weitere Planung jedoch<br />
nicht geklärt war. In der Vor planung haben wir zusammen<br />
mit unserem Restaurierungsberater Julian<br />
Harrap mit dem „Denkmalpflegerischen Leitfaden“<br />
und der „Restaurierungsstrategie“ zwei Doku mente<br />
erarbeitet, in dem alle Bauteile Raum für Raum, die<br />
Fassaden usw., beschrieben, erfasst und in Bezug auf<br />
den Denkmalwert analysiert wurden, also das, was<br />
man üblicherweise bei einem hochrangigen Bau denkmal<br />
macht. Auf der Basis einer detaillierten Bestandsund<br />
Schadenskartierung wurden dann in der Entwurfsplanung<br />
allmäh lich die ersten Überle gungen zu<br />
konkreten pla ne rischen Maßnahmen entwickelt.<br />
Wir wollten uns nicht retrospektiv auf den bauzeitlichen<br />
Zustand beziehen, sondern haben die greif- und<br />
Treppenhaus <strong>im</strong> März <strong>2009</strong>, (Foto: Lenie Beutler)<br />
sichtbar vorhandene Sub stanz zum Ausgangspunkt all<br />
unserer Überlegungen gemacht. Das heißt nun nicht,<br />
dass wir <strong>im</strong> Ein zelfall nicht auch Korrekturen gemacht<br />
hätten. z. B. haben wir teilweise Hochbausicherungen<br />
aus den 1980er Jahren wieder zurückgebaut, weil sie<br />
nicht material- und werktechnikgerecht waren. Im<br />
Einzelfall wurden sogar Eingriffe aus Umbauphasen<br />
vor 1939 ganz revidiert oder doch stark unter drückt.<br />
Der Wiederaufbau der Apsis <strong>im</strong> Griechischen Hof<br />
ist ein solches Beispiel, weil dieser Bauteil strukturell<br />
so wichtig für die Bauzeit und die Idee des Hauses<br />
ist. Diese Entscheidungen waren stets Ergebnis eines<br />
differen zierten Abwägungsprozesses und folgten keiner<br />
schematischen Doktrin.<br />
Eva Schad: Es ist wichtig, dass es keine vorangestellten<br />
kategorischen Richtlinien gab, nach denen<br />
wir gearbeitet haben, sondern wir haben uns in<br />
einem sehr langen Planungsprozess Raum für Raum<br />
und Stufe für Stufe <strong>im</strong>mer tiefer den Fragen gestellt<br />
und die passenden Antworten gesucht. In den ersten<br />
Phasen wurden grundsätzliche Über legungen für die<br />
Räume formuliert, seien sie <strong>im</strong> Ruinenzustand oder<br />
fast vollständig erhalten. Für solche Räume mussten<br />
grund sätzlich unterschiedliche Heran gehensweisen<br />
gefunden werden. Davon ausgehend und <strong>im</strong>mer wieder<br />
vertiefend bricht sich das in den Planungsphasen<br />
runter auf die Einzel entscheidungen zu einer Basis,<br />
einer Säule, einem Kapitell. Man hätte in der ersten<br />
Pla nungsphase manche Fragen gar nicht beant worten<br />
können. Das musste erst wachsen.<br />
Martin Reichert: Diese differenzierte Herangehens<br />
weise ist sicher die stärkste konzep tionelle<br />
Aussage. Wir haben uns von Anfang an sehr bewusst<br />
dazu bekannt, dass wir raum weise entscheiden und<br />
dann diese Einzel entscheidungen und Einzelraumkonzepte<br />
<strong>im</strong>mer wieder unter dem Gesichtspunkt<br />
betrachten, inwieweit sie <strong>im</strong> Gesamt zusammen hang<br />
noch koherent sind.<br />
38<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2009</strong>