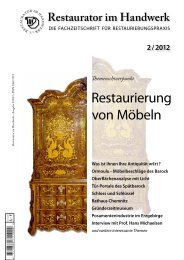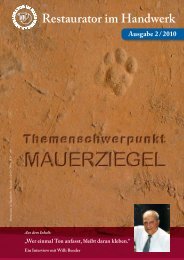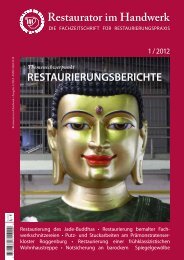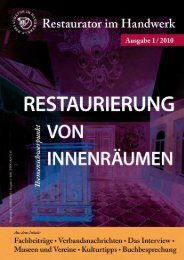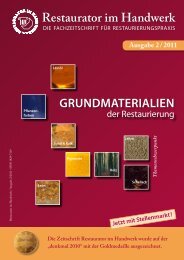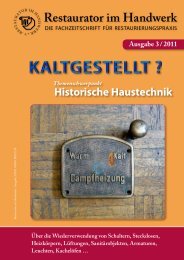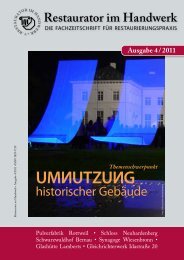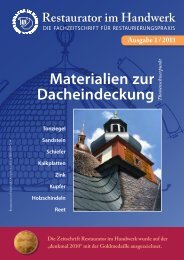Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk â Ausgabe 2/2009 - Kramp & Kramp
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Buchbesprechung<br />
Uni v. Pr o f. Dr. In g . Jo h a n n e s Cr a m e r<br />
TU Be r l i n, Ba u - u n d St a d t b a u g e s c h i c h t e<br />
Nur wenige Bauprojekte der Nachwendezeit haben<br />
in Berlin eine so heftige und so andauernde Kontroverse<br />
ausgelöst wie die Restaurierung und der Wiederaufbau<br />
des Neuen Museums von Friedrich August<br />
Stüler (1843-1859) und nunmehr David Chipperfield<br />
(1999-<strong>2009</strong>). Der aufwändig ausgestattete und schön<br />
organisierte Band dokumentiert zwar nicht den Konflikt,<br />
liefert aber alle Unterlagen, aus denen dieser sich<br />
erklärt. Viele der zahllosen Beteiligten berichten minutiös<br />
aus dem Baugeschehen und von der Suche nach<br />
der richtigen Lösung. Architekt, Bauherr, Ingenieure<br />
und <strong>Restaurator</strong>en kommen zu Wort. Nur die <strong>Handwerk</strong>er<br />
fehlen.<br />
Stülers Aufgabe bestand darin, dem zu klein gewordenen<br />
Alten Museum von Schinkel einen modernen<br />
Erweiterungsbau anzufügen. Hier sollten in<br />
Stilräumen und einem Ambiente, welches die Exponate<br />
unterschiedlicher Epochen erklärend unterstützte,<br />
neue Funde zugänglich gemacht werden. Dazu<br />
nutzte Stüler die neueste Technik und setzte sie ein<br />
<strong>im</strong> modernsten Geschmack seiner Zeit. Der Zweite<br />
Weltkrieg hat das hochberühmte und natürlich auch<br />
veränderte Gebäude schwer beschädigt zurückgelassen;<br />
die DDR hatte nicht die Mittel und auch nicht<br />
den Willen, die Ruine nach dem Ende des Kriegs zu<br />
sichern, so dass vieles von dem, was man 1945 noch<br />
hätte retten können, 1989 unwiederbringlich verloren<br />
war. Dieses Fragment hat eine fruchtbare und heftige<br />
Diskussion um den richtigen Umgang mit Denkmälern<br />
angeregt, die gerade in Berlin besonders nötig<br />
war, weil die Rekonstrukteure des Verlorenen so<br />
scheinbar mühelos die Oberhand gewonnen haben,<br />
dass man meinen könnte, Berlin sei eine völlig rückwärts<br />
gewandte Stadt. Das Neue Museum belehrt uns<br />
eines Besseren. Im Gegensatz zu den Ewiggestrigen<br />
beruht das in einem langen, hier nicht referierten,<br />
aber <strong>im</strong> Buch nachzulesenden Entscheidungsprozess<br />
gefundene Konzept für die Wiederherstellung darauf,<br />
dass das Alte konsequent respektiert und am besten<br />
nur konserviert wird, während das Neue ganz <strong>im</strong> Sinne<br />
Stülers den Stand der technischen und gestalterischen<br />
Möglichkeiten der Zeit zeigen soll. So gehen<br />
das Historische und das Gegenwärtige eine großartige<br />
Verbindung ein. Das mag man unter Geschmacksgesichtspunkten<br />
unterschiedlich beurteilen. Unter dem<br />
Brennglas des Methodischen ist der Vorgang aber<br />
nahezu ein Wunder. Ein Architekt n<strong>im</strong>mt sich vor,<br />
das Alte zu respektieren und zum Maßstab des Neuen<br />
zu machen. Jeder Schritt wird bis in die Einzelheiten<br />
überlegt, abgest<strong>im</strong>mt, geplant und in der Ausführung<br />
überwacht. Die Aussagekraft der Werkplanungen<br />
(z. B. S. 80 und 153) ist phänomenal und die Sorgfalt,<br />
mit der angeblich defizitäre historische Bauteile auf<br />
ihre tatsächlichen Potenziale untersucht wurden, bewundernswert.<br />
Stets stellte sich hier nämlich heraus,<br />
dass die alten Baustoffe und Konstruktionen viel belastbarer<br />
sind, als das unser verunsicherter Baubetrieb<br />
für vorstellbar hielt und hält. Selbst so eigenartige Lösungen<br />
wie die flachen Deckengewölbe aus Tontöpfen<br />
konnten ihre Aufgabe noch ohne ernste Probleme<br />
erfüllen. Ein schöner Beweis für die Nachhaltigkeit<br />
der alten Baustoffe, der jedem Neubau-Liebhaber und<br />
-planer zu denken geben sollte. Doch daraus wäre sicher<br />
keine Kontroverse entstanden.<br />
Die erklärt sich aus dem Konzept des Architekten,<br />
die Ruine als Ruine zu erhalten und modern zu<br />
ergänzen. Die durch Brand und Gewalteinwirkung<br />
geschundenen Oberflächen wurden „nur“ retuschiert<br />
und bleiben uneinheitlich, bisweilen fragmentarisch<br />
(S. 117, 164, 227). Mögliche Ergänzungen unterbleiben.<br />
Das erhaltene und sichtbare Schöne wird durch<br />
das Gestörte komplementiert. Besonders heftig hat<br />
die Debatte um das völlig verlorene Treppenhaus<br />
getobt. Der eindrucksvolle Raum aus dem 19. Jahrhundert<br />
hätte wieder neu geschaffen werden müssen,<br />
um den Bau zu vervollständigen – sagen die Kritiker.<br />
Tatsächlich wurden die Grundstrukturen nachgebildet,<br />
die Oberflächen aber nüchtern und in dem Zu-<br />
Das Neue Museum Berlin<br />
Konservieren, Restaurieren, Weiterbauen <strong>im</strong> Welterbe<br />
Hrsg: Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz,<br />
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Landesdenkmalamt Berlin;<br />
Leipzig (Seemann) <strong>2009</strong>.<br />
240 S., zahlr. farbige Photos und Zeichnungen.<br />
29,90 €,<br />
ISBN 978-3-86502-204-2<br />
48 <strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2009</strong>