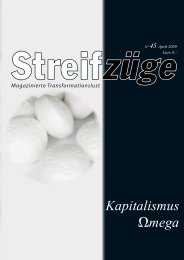streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ROGER BEHRENS, GENTRIFICATION 15<br />
Adorno wohnt trotzdem<br />
Der Mensch im Kapitalismus ist<br />
nicht bei sich zu Hause. Er ist<br />
den gesellschaftlichen Verhältnissen,<br />
die er doch selbst macht, ausgeliefert.<br />
Was inhaltlich nicht nur das Motiv<br />
Marxens war, sondern auch bei Adorno<br />
im Mittelpunkt stand, wollte Letzterer<br />
auch sprachlich zum Ausdruck<br />
bringen. Da das Ich nicht bei sich zu<br />
Hause ist, sollte auch das Reflexivpronomen<br />
sich möglichst weit vom zugehörigen<br />
Subjekt entfernt stehen. Eine<br />
Sprachmacke – aber eine mit Sinn.<br />
Überhaupt spielte das Wohnen bei<br />
Adorno eine besondere Rolle. So lässt<br />
sich in gewisser Weise sagen, dass er<br />
Zeit seines Lebens – und nicht nur<br />
während der Zeit in den Vereinigten<br />
Staaten – im Exil lebte. Denn es sich<br />
einfach häuslich einzurichten im Kapitalismus,<br />
das kam für ihn nicht in<br />
Frage. Stets umgetrieben von dem<br />
Gefühl, der Faschismus könne zurückkehren,<br />
hatten er und seine Frau<br />
Gretel die Wohnung in Frankfurt<br />
niemals wirklich eingerichtet.<br />
In den Minima Moralia formulierte<br />
er das grundsätzliche Problem kritischer<br />
Intelligenz, am Widerspruch<br />
Areale, ganze Dörfer und Kleinstädte<br />
baulich erschlossen wurden.<br />
Mit dem Ende des „goldenen Zeitalters“<br />
der Wohlstandsgesellschaft sind die<br />
Städte selbst ungeheuren Transformationen<br />
unterworfen: Die rücksichtslose<br />
Kommodifizierung des Wohnens heißt<br />
nun nicht mehr, einfach aus der Vermietung<br />
eines Schutz- und Ruheraums Profit<br />
zu schlagen, sondern den Wohnraum<br />
als Ware sich über die „urbane Lebensqualität“<br />
gleichsam selbst rechtfertigen<br />
zu lassen: das heißt nicht nur, bereitwillig<br />
in einem als „chic“ geltenden Stadtteil<br />
überproportional mehr Miete zu zahlen,<br />
sondern auch die endgültige Bestätigung<br />
des Fetischcharakters dieser Ware, nämlich<br />
dass Wohnraum, Strom, Wasser etc.<br />
natürlich, d.h. selbstverständlich bezahlt werden<br />
müssen.<br />
Transformation der Städte<br />
Auch diese Transformation der Städte<br />
wird nach wie vor von einer Idee des<br />
Wohnens begleitet, die sich an der wie<br />
2000 Zeichen<br />
von Anspruch und Wirklichkeit<br />
nicht zu vergehen, am Beispiel des<br />
Wohnens. Egal welche Wohnform,<br />
egal welchen Typus von Architektur<br />
die Einzelnen auch wählen mögen:<br />
überall sei es im Grunde unmöglich,<br />
schadlos zu wohnen.<br />
Wer in seinen eigenen vier Wänden<br />
wohne, der mache sich schuldig,<br />
solange anderen das Wohnen versagt<br />
bliebe. Doch ohne Wohnung steige<br />
nur die Abhängigkeit von den gesellschaftlichen<br />
Bedingungen. Und<br />
wer wollte schon an der „lieblosen<br />
Nichtachtung der Dinge“ teilhaben,<br />
die doch dem Kapitalismus immer<br />
schon innewohnt? Wobei auch das,<br />
kaum ausgesprochen, schon zur Ideologie<br />
wird für jene, „welche mit<br />
schlechtem Gewissen das Ihre behalten<br />
wollen.“<br />
In genau diesem Sinne gibt es<br />
„kein richtiges Leben im falschen“.<br />
Nicht, dass wir nun eine Ausrede<br />
hätten, nichts zu tun. Wir müssen nur<br />
um die Beschränktheit unseres Handelns<br />
wissen und es stets aufs Neue<br />
auf seine praktischen Folgen für unser<br />
Leben und das Streben nach Emanzipation<br />
befragen.<br />
J.B.<br />
abwärts<br />
auch immer idealisierten Vorstellung der<br />
Lebensweise des Adels orientiert. Deshalb<br />
verwundert es nicht, dass bei einigen<br />
dieser städtischen Veränderungen in<br />
den achtziger Jahren nun von „Gentrification“<br />
gesprochen wird: der Begriff<br />
leitet sich vom englischen ‚Gentry‘ her,<br />
womit ehedem der niedere Adel vom<br />
höheren Adel (‚Peers‘, ‚Nobility‘) unterschieden<br />
wurde; die Gentry waren indes<br />
den einfachen Bürgern sozial und rechtlich<br />
übergeordnet. Einer der Protofälle<br />
der Gentrifizierung war in den achtziger<br />
Jahren in Manhattan (New York),<br />
insbesondere in Soho zu beobachten: In<br />
den von Zerfall und Armut betroffenen<br />
und von „sozial Schwachen“ bewohnten<br />
Viertel zog nun ein neuer „niederer<br />
Adel“, nämlich jugendliche und<br />
jung-erwachsene deklassierte Bürger<br />
und Kleinbürger, die ihre Lebensweise<br />
zwar vom Establishment abgrenzten,<br />
aber dennoch aufwerteten, indem sie<br />
ihre Lebensweise als bewussten Lebensstil<br />
erhöhten; sie – Studenten, Künstler,<br />
erfolglose Kleinunternehmer, gut ausgebildete<br />
Teilzeit-Jobber, die ersten professionellen<br />
Computer-Nerds etc. – eroberten<br />
Stadteile wie Soho als Bühne,<br />
für die Häuser, Straßen und alle anderen<br />
Bewohner nur eine – letzthin austauschbare<br />
– Kulisse darstellten: so konnten sie<br />
gerade in diesen Problemgebieten ein<br />
innerhalb der allgemeinen etablierten<br />
Maßstäbe nicht sonderlich erfolgreiches,<br />
kohärentes Lebensmodell als homogene,<br />
schließlich an diesem Ort auch hegemoniale<br />
Subkultur inszenieren; dies war<br />
schnell ökonomisch attraktiv, weil diese<br />
Subkultur einen riesigen neuen Arbeitsund<br />
Absatzmarkt bot, über den sich dieser<br />
„neue niedere Adel“ scheinbar autark<br />
und alternativ, schließlich finanziell erfolgreich<br />
versorgen konnte: Was Anfang<br />
der achtziger Jahre in den USA als Yuppisierung<br />
(Yuppie = young urban professionals)<br />
begann, endete mit dem Zerplatzen<br />
der New Economy-Blase um 2000.<br />
Was sich in diesem Zeitraum in den<br />
Metropolen an Gentrification vollzog,<br />
war zwar räumlich auf einzelne Stadtteile<br />
beschränkt, fand aber seine Parallele<br />
in einer neuen Form des konsumistischen<br />
Individualismus, mit der sich ein<br />
Sozialcharakter des „autonomen Konformisten“<br />
konstituierte, der sich vorrangig<br />
über verschiedene Selbst-Ästhetisierungsstrategien<br />
definiert. Zu<br />
diesen Strategien gehört nach wie vor<br />
die „bewusste“ Entscheidung für einen<br />
Wohnort, der mit einem Lebensstil<br />
beziehungsweise mit Lebensqualität<br />
identifiziert wird. Diese Identifikation<br />
ist allerdings heute keine produktive<br />
und kreative mehr (wonach ein bestimmtes<br />
Image eines Viertels erst im<br />
Alltag hergestellt wird), sondern funktioniert<br />
reproduktiv und rezeptiv als reiner<br />
Schematismus (wonach ein erwartetes,<br />
vorgegebenes Image eines Viertels<br />
adaptiert beziehungsweise konsumiert<br />
wird).<br />
Für die gegenwärtig in den Städten zu<br />
beobachtenden Transformationsprozesse,<br />
vor allem dort, wo auch heute wieder<br />
von Gentrifizierung gesprochen wird, hat<br />
dies aberwitzig erscheinende Konsequenzen:<br />
Gerade in den Stadtteilen Schanzenviertel,<br />
St. Pauli, Altona, Karolinenviertel<br />
und auch Wilhelmsburg sind es Gentrifizierungsgegner,<br />
die eine erste Gentrifizierungswelle<br />
vor zehn oder fünfzehn<br />
Jahren selbst in Gang gesetzt haben. Insgesamt<br />
wird deutlich, dass die Idee kultureller<br />
Aufwertung mit ihrem eigentlichen<br />
ökonomischen Zweck nicht kompatibel<br />
ist und eine Gentrifizierungskritik,<br />
die nur den eigenen Freiraum, Lifestyle<br />
LIVING ROOM<br />
<strong>Streifzüge</strong> N° <strong>47</strong> / Dezember 2009